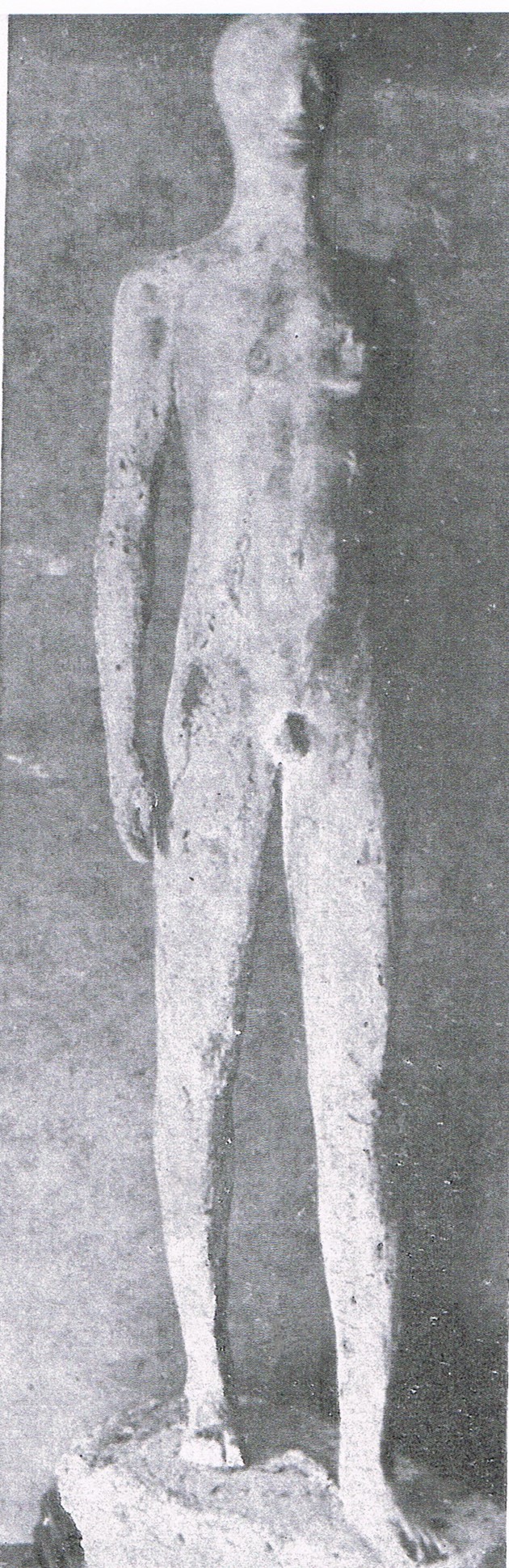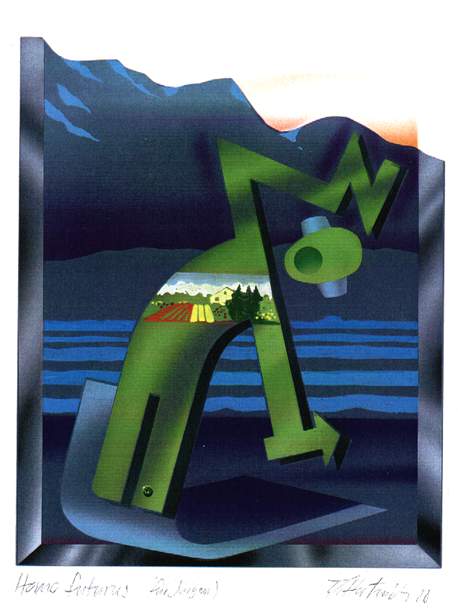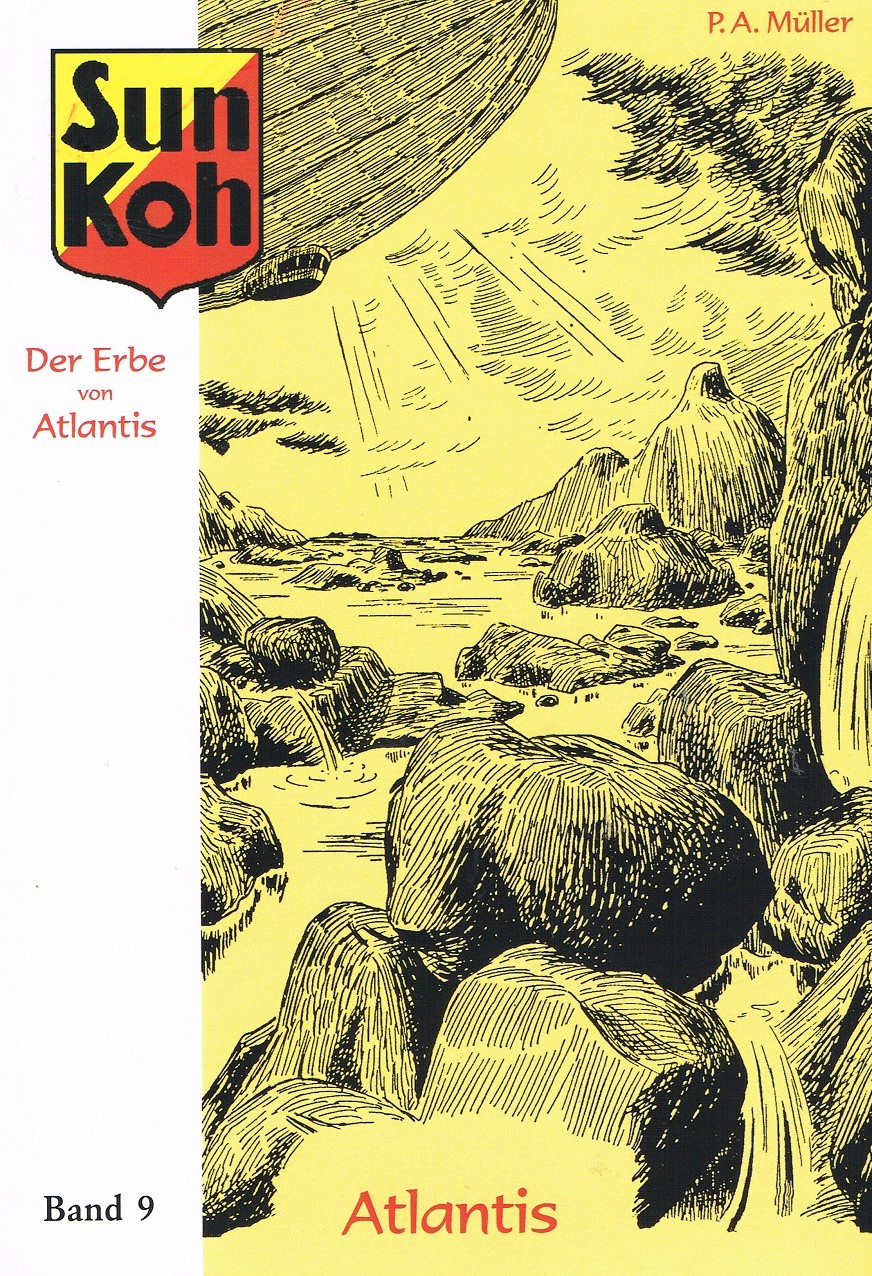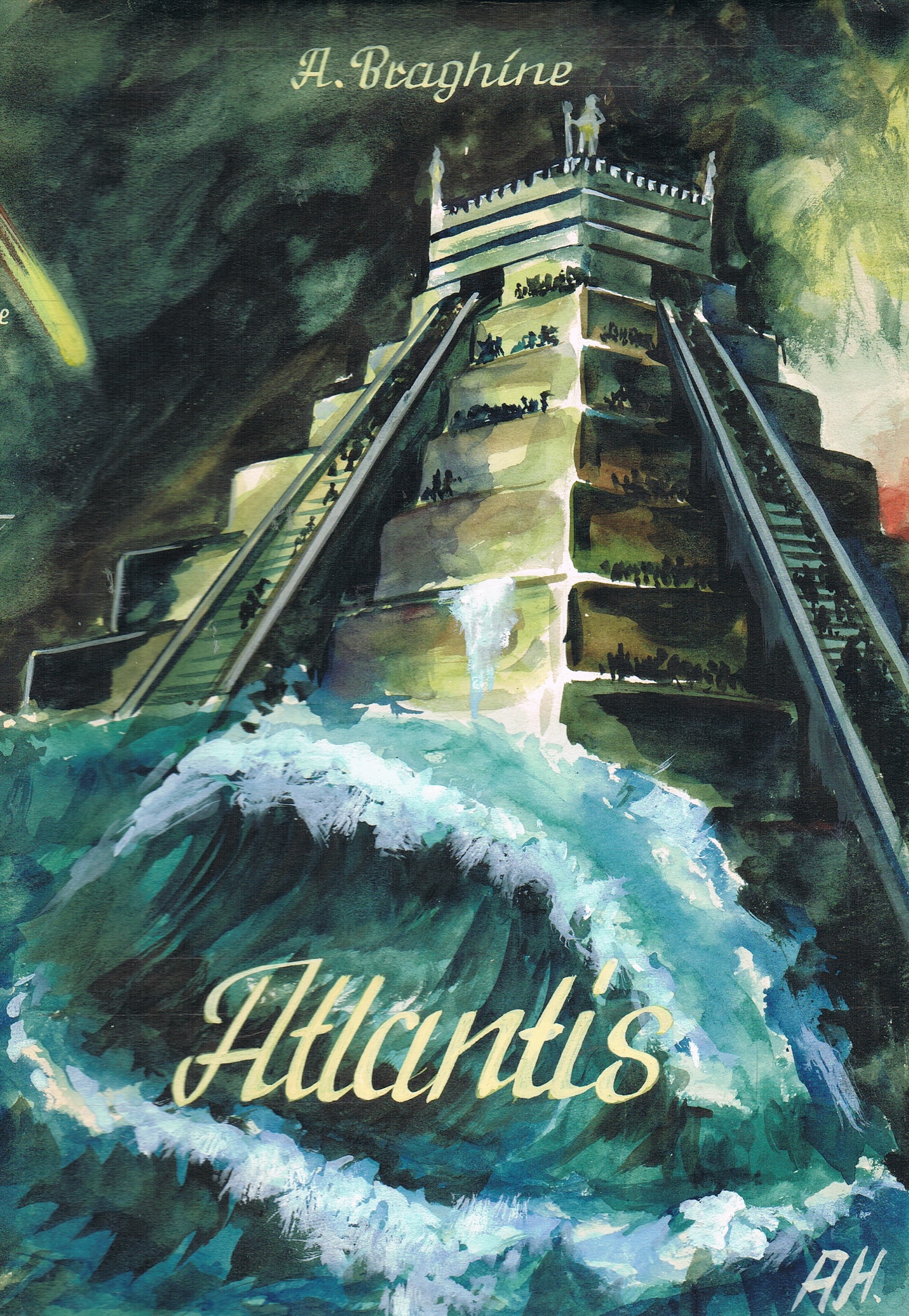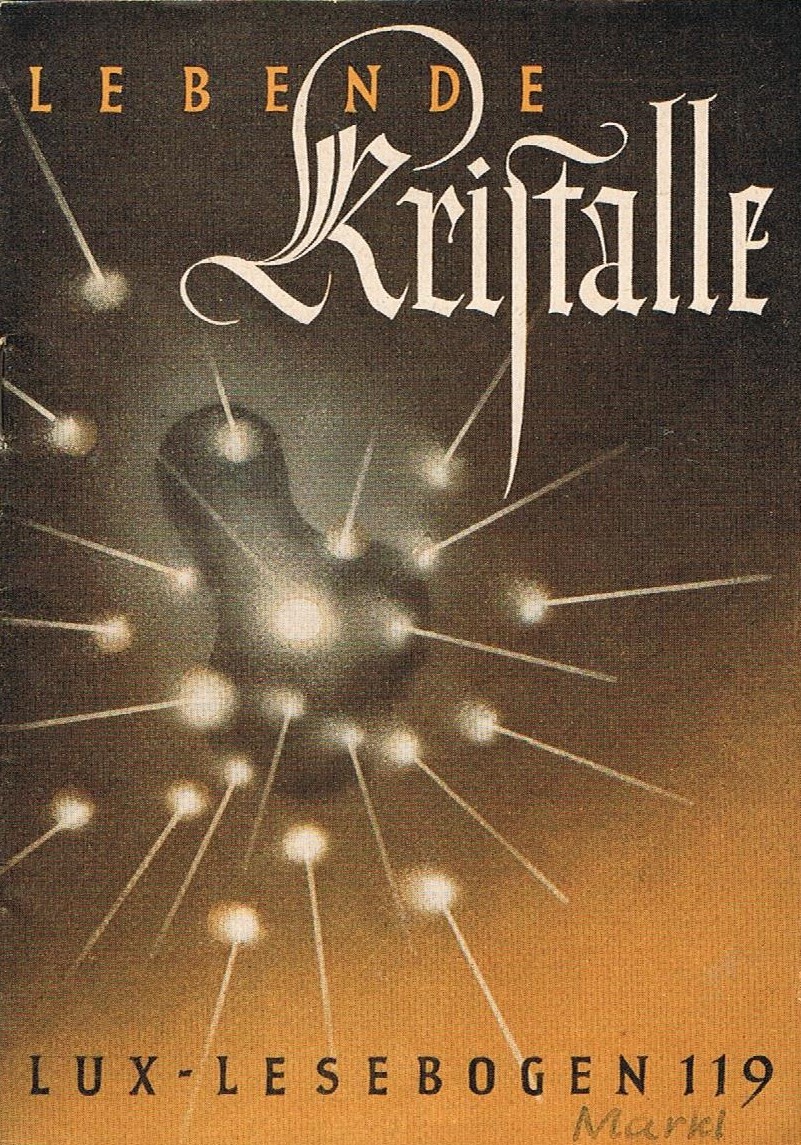In diesem Blog präsentiere ich immer wieder auch Geschichten, die ich irgendwann geschrieben und nie veröffentlicht habe. Meistens sind sie in einer meiner Schreib-Werkstätten entstanden, wo ich alle Aufgaben und Übungen immer mitmache, schon um im “kreativen Fluss” dabei zu sein. Dies ist so eine Geschichte. Sie ist für einen Blog ein wenig lang geraten – aber in meinem Blog darf das ruhig gelegentlich vorkommen.
Manches darin ist autobiographisch – aber dann hat sich meine Phantasie selbständig gemacht. Und so soll es ja sein, auch hier beim HERZSTILLSTAND. –
Thomas Lauffner hielt inne. Die Finger, die eben noch über die Tastatur seines Computers gehuscht waren, verharrten wie eingefroren. Dieser Schmerz in der linken Seite – Seitenstechen? Das Herz? Leise pfeifend entwich die Luft aus seinem Mund, die seine Lungen reflexartig zurückgehalten hatten. Er wagte kaum, sich zu bewegen. Langsam zog er die Finger von der Tastatur zurück, ließ die Hände an den Seiten herabsinken. Ausatmen – einatmen – ausatmen – einatmen – ausatmen – wie er es im Yogaunterricht gelernt hatte. Das half.
Ein Erinnerungsbild taucht vor den Augen auf, die sich erleichtert geschlossen hatten. Am Vortag hatte er sich mit Freunden im Biergarten am Chinesischen Turm getroffen. Doch kaum hatten sie ihre frisch gefüllten Bierkrüge und die großen Laugenbrezen vor sich auf dem mitgebrachten Tischtuch abgestellt, als es aus den grauen Wolkengebirgen hoch über ihnen doch zu tröpfeln begann. Langsam erst, dann immer heftiger. Die Freunde waren gleich losgestürmt, hatten Bier und Brezen und Tischtuch lachend zurückgelassen, “Tschüs” rufend, um erst Schutz unter dem altersgrauen hölzernen Turm zu suchen, dann auch ohne Schirm rüber zur Bushaltestelle, ohne weiteren Abschied –
Er war sitzen geblieben, irgendwie ermattet vom Tag. Schaute dem Personal zu, das die leeren Krüge einsammelte. Sah die Musiker von der oberen Etage des Turms herabsteigen, die Instrumente fest an sich gepresst. Irgendwann saß er nur noch allein da, schaute und hörte dem Regen zu, fühlte die damit gekommene Kühle in sich hineinkriechen –
Irgendwann war er aufgesprungen und, den Regen missachtend, rüber zur Bushaltestellte gerannt. Dort saß er eine Weile schnatternd vor Kälte, bis er Bus kam.
Warum fällt mir das ausgerechnet jetzt ein? Lauffner drehte die Sanduhr um und zog widerstrebend das Buchungsjournal zu sich. Prüfend ging er die Eintragungen durch.
Semele – seltsames Wort. Plötzlich war es in seinem Kopf.
Thomas Lauffner hielt inne. Seine Rechte blieb mit der Spitze des Kugelschreibers in der Zeile stehen, in der es hieß:
“31. Oktober. Ausgang: 91.14. MWST 7 %. Buch.”
Im Gegensatz zu vielen anderen Buchungen musste er bei dieser nicht lange herumrätseln, was sie bedeutete. Der Gesamtpreis betrug 98.- Mark und der Titel des Buches konnte nur Labyrinthe heißen. Ein teurer Bildband, den Lauffner am Infostand des Seminars erstanden hatte, das der Autor in der Evangelischen Akademie in Tutzing zum gleichen Thema anbot hatte. Im Schlosspark hatten die 120 Teilnehmer mit Steinen die kreisähnliche Anlage eines kretischen Labyrinths angelegt und sich in kleinen Gruppen redend und schreibend und malend und tanzend mit dem faszinierenden Thema beschäftig. Am interessantesten war es gewesen, gemeinsam ein Labyrinth auf der großen Weise der Akademie auszulegen, direkt am Starnberger See. Er erinnerte sich noch an die Kälte des Wassers, als er am Ufer seine Steine auswählte. Ende Oktober war der Starnberger See schon sehr abgekühlt. Sieben Mal war er gelaufen, jedesmal bepackt mit dicken Seekieseln. Sein Gesicht hatte geglüht vor Begeisterung, während sie unter der Anleitung des Autors die Struktur auslegten.
Nicht lange danach der Schock, in der Zeitung beim Frühstück den Nachruf zu lesen: Überraschend für alle sei Hermann Kern, erst 42 Jahre alt, verstorben…
Semele – wieder dieses Wort! Was bedeutete es? Aber er hatte jetzt keine Zeit, Geheimnissen nachzuspüren. Er musste die Buchführung nochmals genauestens überprüfen. Dann die Unterlagen zum Computer-Service, der eine bildsaubere Aufstellung seiner Einnahmen und Ausgaben liefern würde. Er notierte für die Frau, die ihm die Buchführung machte, dass sie in Zukunft die Titel der Bücher notieren solle.
Er hatte keine Lust, sich wieder stundenlang mit einem Steuerprüfer auseinanderzusetzen, der bezweifelte, dass er wirklich jedes Jahr für zwei- bis dreitausend Mark Bücher kaufen müsse.
“Kann man die denn nicht in der Bibliothek ausleihen?”
“Warten Sie mal in der Stadtbibliothek auf ein Buch!” hätte er am liebsten losgebrüllt. Aber er war freundlich geblieben, hatte nur ironisch gesagt, dass er diese Bücher ja in vielen Fällen mehr als einmal benütze und als Journalist und Buchautor gerne seine Berufskollegen unterstütze – von denen erwarte er ähnliche Freundschaftsbezeugungen.
“Ausgaben 124,80 DM. 14 % MWST. Tutzing.” Das war die Abrechnung der Tagesspesen für diese Tagung. Wie oft hatte er Frau Lemmer schon gesagt, dass der Vermerk “F” für Fortbildung wichtig war, sobald es um Spesen ging!
Ein Marienkäfer landete sanft auf seinem Handrücken und der Stift verharrte erneut. Ausgaben 9.00 DM. 14 % MWST. Fahrtkosten Tutzing.” Das war die Hin- und Rückfahrt mit der S-Bahn gewesen.
“Thomas -” Das war die Stimme seiner Frau. Er schaute stirnrunzelnd vom Journal auf. “Kannst du mal eben nach Joschi schauen?” sagte sie, “ich muss beim Kaufmann um die Ecke noch den Spargel und den Schinken holen – Hast du heute Morgen übrigens die Mayonnaise mitgebracht?”
“Liegt bereits im Eisschrank.” (Seltsam, dass er noch immer “Eisschrank” statt Kühlschrank sagte, ein Relikt aus der Kindheit.)
Joschi drängte sich neben Stefanie ins Arbeitszimmer. “Leg mir die Schlümpfe auf, Papa”, rief er.
Lauffner spürte, wie Ärger in ihm hochkroch. “Du weißt genau, dass ich bis heute Abend diesen Mist für die Steuer durchgesehen haben muss, weil der morgen früh im Computer-Zentrum sein muss -” Das wollte er sagen. Aber behielt es für sich. “Fünf Minuten, Thomas, sei kein Frosch, leg ihm die Platte auf und du hast deine Ruhe.”
“Ruhe? D die Platte läuft gerade mal drei Minuten, dann muss ich sie umdrehen und drei Minuten später wieder -“
“Dann leg ihm die Zauberflöte drauf. Die mag er auch gern. Und die dauert mehr als eine halbe Stunde.”
Sie wandte sich direkt an den Dreijährigen: “Du magst doch die Zauberflöte auch?”
“Schlümpfe“, kam es bestimmt zurück.
“Also, leg ihm die Schlümpfe auf. Und dann die Zauberflöte. Dann hast du wirklich deine Ruhe. Und dann bin ich sowieso wieder zurück.”
Lauffner schüttelte den Marienkäfer von der Hand. Er ging zum Plattenspieler und legte die Kinderplatte auf.
“Tanz mit mir”, sagte Joschi.
“Mag nicht, muss meine Hausaufgaben noch machen.”
“Hausaufgaben? Warum?”
“Das verstehst du nicht: Steuern, Buchführung. Finanzamt.”
“Warum?”
“Warum Finanzamt? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Aber ein Wirtschaftsjournalist sollte sowas besser nicht laut fragen.”
“Warum, Papa?”
“Nerv mich nicht, Joschi!”
“Ist Finanzamt lustig?”
“Oh ja, sehr lustig. Komm, tanzen wir.” Er fasste den Kleinen, und als sie sich zu der launigen Musik durchs Zimmer drehten, um den Großvatersessel, um das Holztischchen, um die anderen Sessel, da war ihm auf einmal ganz wohl. Tanzen. Das war´s. Wir sollten wieder einmal tanzen gehen – “das Tanzbein schwingen”, so lockte sie ihn immer wieder. Aber irgendwie war ihm die Lust dazu vergangen. Das lag vielleicht daran, dass sein rechtes Knie nach dem letzten Schwof tagelang rumort hatte.
Die Platte war zu Ende. Er setzte den Dreijährigen ab und drehte die Schlümpfe um.
“Werf mich hoch, Papa, ganz hoch.” Das war ein Spiel, das sie beide gerne spielten. Und viel zu wenig, wie Thomas wieder einmal bewusst wurde. Sie hatten das vor einem Jahr entdeckt, im Urlaub auf der Insel Giglio, auf dem Sand der kleinen Badebucht. Den Kinderkörper fassen, sich in die Augen schauen, Luft anhalten – und ihn hochwerfen, so hoch es ging. Gute drei Meter. Bei den ersten Malen war er natürlich zurückhaltender gewesen, hatte Joschi kaum über seinen eigenen Kopf geworfen. Aber dann war mit dem Spaß am Spiel der Mut gewachsen und das gegenseitige Vertrauen.
“Höher, Papa” hatte Joschi gerufen, “noch höher. Und noch mal.”
Er warf ihn hoch. Es gab ein kleines, ganz sanftes Geräusch. Das war alles. Merkwürdig war nur, dass Joschi oben an der Decke blieb, die er mit Kopf und Körper eben berührt hatte, als er so hoch wie nie zuvor in der Altbauwohnung geflogen war. Kurz vor der Berührung hatte Joschi noch seinen wilden Freudenschrei ausgestoßen, wie er es in der letzten Zeit gerne machte, und dabei mit seinen Armen und Beinen gewackelt, als wollte er wegfliegen. Dann Stille.
Thomas Lauffner bemerkte, dass sein Kinn kraftlos herunterhing und sein Mund weit klaffte vor Staunen. Das war, als das Staunen noch alle anderen Empfindungen überlagerte. Dann kroch allmählich etwas anderes in ihm hoch. “Joschi”, sagte er heiser. “Joschi, komm bitte wieder runter.”
Aber der Kleine blieb oben. “Papa, du bist so weit weg”, sagte Joschi schüchtern.
“Komm bitte runter, Joschi.” Thomas stand mit wartend ausgebreiteten Armen und Händen, um den Körper aufzufangen, sobald er zurückfallen würde. Aber er fiel nicht. Und dann war da wieder dieses eigenartige Wort in seinem Kopf, das ihn schon beim Arbeiten gestört hatte. Semele. Den ganzen Morgen. Er sollte im Lexikon nachschauen, wer oder was das war, damit wieder Ruhe eintrat. Was konnte Semele schon sein?
Aber es war unmöglich, jetzt zum Bücherschrank zu gehen. Was auch immer veranlasste, dass Joschi, entgegen der Schwerkraft, oben an der Decke hängen blieb – diese Kraft konnte jeden Moment wieder nachlassen. Und dann müsste er auf seinem Posten sein, um Joschi aufzufangen. Er hatte ihn schließlich dorthin befördert.
Warum kam Stefanie nicht zurück? Sie war doch schon viel länger weg als fünf Minuten. Es war anstrengend, abwartend so zu stehen und mit gesammelter Aufmerksamkeit immer nur nach oben zu schauen.
Er hatte schon vor einer halben Stunde mal aufs Klo gehen wollen. Warum hatte er es bloß nicht getan? Jetzt wurde der Druck in seiner Blase immer drängender, je mehr die Zeit verging.
Wie spät war es denn eigentlich? Sein suchender Blick fand keine Uhr an seinem Handgelenk. Durch die Tür zum Arbeitszimmer, die halb offenstand, konnte er die Sanduhr auf seinem Schreibtisch sehen.
Sie lief, wenn sie umgedreht wurde, exakt 55 Minuten. Er benützte sie gerne bei Arbeiten, die er verabscheute. War der Sand durchgelaufen, gönnte er sich guten Gewissens eine kleine Pause. Begann ihn die Arbeit wider Erwarten doch noch zu fesseln, übersah er die Sanduhr, und das war recht so.
Jetzt pendelte sein Blick dauernd zwischen Joschi oben an der Zimmerdecke mit den Stuckverzierungen und dem gläsernen Doppelkörper auf dem Schreibtisch, dessen Sand anzeigte, dass ungefähr eine halbe Stunde vergangen war. Seit wann? Er hatte die Uhr umgedreht, als Stefanie und Joschi gerade ins Zimmer kamen. Dann das Tanzen, vielleicht fünf Minuten Hochwerfen.
“Papa”. Die Stimme war noch immer ganz vergnügt. Es sah aus der Distanz von etwa fünf Metern so aus, als sei die Standuhr stehengeblieben. Aber so genau konnte er das nicht erkennen. Die Anstrengung des genau Hinsehens machte ihm wieder die starken Spannungen in seinen Augen bewusst. Er suchte, natürlich nur mit Blicken, nach der Brille, die er abgelegt hatte, ehe er Joschi zum Tanzen hochhob. Lag sie dort auf dem Spanischen Schränkchen?
Die großen Buben hatten das Schränkchen bei einer Rauferei umgeworfen und sämtliche Gläser zerschlagen, die darin aufbewahrt wurden. Der materielle Schaden, etwa 600.- Mark, wäre noch zu verschmerzen gewesen (ein paar Urlaubstage weniger, mehr kaum). Aber die Erbstücke aus der Vitrine des Urgroßvaters, die über die Mutter auf ihn gekommen waren –
“Papa, ich will wieder runter!”
Verwirrt wurde Lauffner sich bewusst, dass seine Gedanken abgedriftet waren und er – für wie lange? – völlig vergessen hatte, dass Joschi oben an der Zimmerdecke schwebte. Wie war sein Gesichtsausdruck? Ohne Brille konnte er es nicht genau erkennen. An der Stimme war nichts Ungewöhnliches festzustellen.
“Komm doch einfach wieder, lass dich fallen -“
Thomas versuchte seiner Stimme einen scherzenden Unterton zu geben, versuchte unbekümmert zu erscheinen. Aber es gelang ihm nicht recht.
“Eigentlich dürftest du gar nicht dort oben sein, von Rechts wegen – ich meine wegen dem Gesetz der Schwerkraft. Du wiegst doch bestimmt mehr als zwanzig Kilo – wie schwer bist du eigentlich, Joschi?”
“Was?”
“Die Mama hat dich doch neulich gewogen. Was hat sie gesagt, wie schwer du bist?”
“Weiß ich doch nicht. Ich will runter, Papa.”
Was würden andere Kinder darum geben, mal oben an der Zimmerdecke zu schweben! Aber vielleicht dauerte der ungewöhnliche Zustand schon zu lange? Wie lange eigentlich? Wenn er bloß die Uhr sehen könnte. Irgendeine Uhr. Wo nur Stefanie blieb. Fünf Minuten hatte sie gesagt! Mindestens eine halbe Stunde musste sie jetzt schon aus dem Haus sein, mindestens –
“Papa, hol mich wieder runter!” Das klang schon reichlich kläglich.
“Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Joschi. Vielleicht kann ich die Sessel aufeinander stapeln, das sollte doch reichen.”
Er versuchte, den nächsten der beigen Polstersessel zu fassen. Obwohl er nur mit Schaumstoff gefüllt war, ließ er sich nicht vom Platz rücken; er haftete wie festgeschraubt am Teppichboden.
War das Kohäsion? Er hatte doch in der Schule mal was gelernt, weshalb manche Körper fest aneinander klebten, wenn ihre Oberflächen entsprechend beschaffen waren – “Papa! Die Mama soll kommen und mich runterholen.”
“Gleich kommt sie zurück. Sie ist nur rasch zum Einkaufen gegangen.” Das hatte sie jedenfalls gesagt. Aber warum kommt sie nicht?
“Ich gehe nur ein paar Schritte weg, um die Sessel näher zu holen, Joschi. Dann stelle ich sie aufeinander und hole dich runter.” Er schaute sich suchend im Zimmer um, welches der Möbel am nächsten und geeignetsten war.
“Nicht weggehen, Papa!”
“Keine Angst, ich gehe nicht weg, nur zwei Schritte -“
“Nicht weggehen!” Das Kind zeigte jetzt erste Zeichen von Panik.
Ich muss mit ihm reden, ihm eine Geschichte erzählen, dachte Thomas. Aber was für eine Geschichte! Mir fällt doch jetzt keine Geschichte ein, die ich locker erzählen kann, ich müsste die Klappleiter holen, draußen in der Besenkammer, gleich beim Staubsauger. Wieviele Schritte sind es bis dorthin? Zur Tür des Wohnzimmers vielleicht fünf Meter. Als wir die riesige Altbauwohnung bekamen, haben wir uns über ihre Dimensionen nur gefreut. Aber was macht man in einer solchen Situation, wenn schon der Weg über den Flur gute zehn Meter lang ist.
Wieviele Sekunden dauert das, dort zur Tür zu rennen, sie aufreißen, über den Flur rennen, die Kammertür aufreißen, die Leiter packen, zurück über den Flur, was mit der Leiter natürlich nicht so schnell geht – das dauert ja nicht Sekunden, sondern Minuten – in einem Neubau gäbe es das Problem nicht – aber da hätten wir auch keine Leiter nötig und die Zimmerdecke wäre nicht drei Meter vierzig hoch, sondern allenfalls zwei Meter zwanzig, oder so.
“Papa – hol’ mich runter -“
“Jetzt wein’ nicht.” Warum eigentlich nicht? Vielleicht hilft’s ihm, wenn er weint. Ist doch kein Indianerjunge, der tapfer sein und Tränen zurückhalten muss. Wie wäre das denn, wenn ich drei Jahre und fünf Monate alt wäre und dort oben an der Decke schwebte? Verdammt, der Nacken begann zu schmerzen. Aber sobald er den Kopf senkte und die Augen abwandte, begann Joschi angstvoll zu rufen. “Jetzt weiß ich eine Geschichte”, sagte Lauffner.
“Eine Geschichte?” Joschi klang für den Augenblick etwas hoffnungsvoller.
“Ja. Ich erzähle dir die Geschichte von Semele.” Wer, um Himmels Willen, war Semele? Aber für eine erdachte Geschichte war das doch gleich. Er würde diese Gestalt und was sie tat einfach erfinden, so wie er am Abend zuvor die Geschichte vom Feuerdrachen und den beiden Wasserdrachen erfunden hatte, die Joschi so gut gefiel.
“Erinnerst du dich noch an die Wasserdrachen von gestern, Joschi?”
“Ja, Papa. Die Lausbuben-Drachen.”
Semele – Selene – die beiden Mädchen, die sich auf dem Spielplatz küssten, wobei unklar blieb, ob das eine nicht doch ein Junge war –
Sein Nacken schmerzte unerträglich; lange würde er das nicht mehr aushalten. Die Tür ging auf, Stefanie kam herein, unter beiden Armen braune Einkaufstüten.
“So, da bin ich wieder, ihr beiden – habt ihr schön gespielt?”
In diesem Augenblick zog jemand einen großen schwarzen Vorhang zu. Eine feurige Zunge leckte von seinem Nacken und von dort weiter in sein Herz. Er hörte noch seinen Namen rufen –
*
Als er die Augen wieder aufschlug, war alles um ihn her weiß. Nur das Gesicht des Menschen, der sich gerade zu ihm beugte, war zart rosa, nein hellbraun, darunter ein kräftiger orangefarbener Fleck, eine Bluse, wie er erkannte, die oberen Knöpfe offen, so dass er die Ansätze der Brüste deutlich erkennen konnte, auch sie leicht gebräunt. Eine andere Farbe schob sich in sein Gesichtsfeld, ein helles Lila, verbunden mit einem Geruch, der ihm vertraut war.
“Flieder”, sagte er. Dann erkannte er das Gesicht hinter den Blütendolden und den ovalen, spitz zulaufenden Blättern. Das Gesicht schwebte jetzt, wie losgelöst, über dem Fliederbuschen.
“Stefanie”, sagte er. Ihm wurde bewusst, wie müde er war. “Was ist das für ein Zimmer? Wo bin ich hier?”
“In der Klinik.”
“Was ist passiert?”
“Erinnerst du dich nicht mehr? Du hast mit Joschi gespielt. Als ich vom Einkaufen zurückkam, fingst du ihn gerade wieder auf. Du hattest ihn hochgeworfen, erinnerst du dich nicht mehr?”
“Ja, das stimmt. Ich habe ihn hochgeworfen. Aber es dauerte so lange. Und dann dieser schwarze Vorhang. Die Lichter. Da waren auch Lichter. Und ein Name -“
“Semele? War es das? Du bist mit Joschi umgestürzt, lagst wie ohnmächtig da. Semele, hast du gesagt, ganz laut und deutlich, obwohl das gar nicht möglich ist. Die Ärzte sagen, es wäre ein Herzinfarkt – und nicht der erste. Da gibt es bereits Narben an deinem Herzen – Aber ich sollte nicht so viel reden.”
“Doch, erzähl weiter. Wie lange warst du weg?”
“Meinst du jetzt eben?”
“Nein, bevor du mich gefunden hast -“
“Vielleicht zehn Minuten, war nur rasch um die Ecke beim Einkaufen -“
“Nicht länger?” Er sah Joschi oben an der Decke schweben, während Minute um Minute verging, quälend langsam –
“Habe ich das alles geträumt?”
“Was?”
Er zögerte. “Da war etwas Eigenartiges, vielleicht kann ich es dir später erzählen. Und Joschi – wie geht es ihm?”
“Was soll mit ihm sein? Er fragt ständig nach dir. Du sollst ihn hochwerfen, danach verlangt er immer wieder.”
“Und er hat keine Angst?”
“Wovor sollte er Angst haben, Thomas?”
“Vor dem Hochwerfen!”
“Ich denke nicht. Vielleicht fragst du ihn morgen selber, ich bringe ihn mit. “Sie öffnete ihre Handtasche und zog ein Blatt Papier heraus.
“Hier, falls es dich interessiert. Ich hab mal nachgeschaut, was das heißt – Semele – das Wort.”
“Ach ja, Semele. Das Wort ist mir an dem Tag immer wieder durch den Kopf gegangen -“
“Erst dachte ich, du meinst Semmeln -“
“Semmeln?”
“Wäre möglich gewesen. Du hattest nämlich vergessen, die Semmeln für’s Frühstück am Sonntag mitzubringen, die wir aufbacken wollten, erinnerst du dich? Du bist zur Post gegangen, zum Schließfach, und wolltest auf dem Rückweg beim Bäcker vorbeigehen -“
Er schaute sie verständnislos an. “Ich muss es wohl vergessen haben. Aber auf dem Zettel, was steht da?”
“Ich habe im Lexikon nachgeschaut, was Semele heißt -“
“Ist das nicht eine Mondgöttin in der griechischen Mythologie gewesen?” unterbrach er sie, “als Jugendlicher haben mich diese Geschichten sehr fasziniert.”
“Nein, nicht die Mondgöttin, die heißt Selene. Semele ist eine der Frauen, die Zeus in einer seiner vielen Verwandlungen geschwängert hat -“
“Geschwängert?”
“Semele hat er als goldenen Funkenregen betört -“
“Eine etwas eigenartige Form, eine Frau zu beglücken, findest du nicht auch?”
“Ach, ganz wie man’s nimmt – eigentlich beschreibt es den Vorgang doch ganz gut, findest du nicht?”
Sie schauten sich eine Weile nur stumm an. Aber in ihren Blicken ging viel Gefühl hin und her, während jeder für sich seinen Gedanken und Erinnerungen nachhing. “Wir haben lange nicht mehr miteinander geschlafen”, sagte er endlich, und er spürte ein eigenartiges Würgen im Hals, kein schlechtes Gefühl, wie er merkte. Stefanie wischte sich einige Tränen aus dem Gesicht.
“Das war knapp, Thomas. Haarscharf am Tod vorbei – Herzstillstand.”
Er nahm ihre Hand und führte sie an seine Brust. “Es schlägt wieder, spürst du’s? Ganz ruhig und regelmäßig.” Sie ließ die Hand eine Weile dort ruhen, wo er sie hingelegt hatte. Dann fasste sie mit beiden Händen sein Gesicht und streichelte es, ganz langsam. “Werde bald gesund, “Semele wartet.”
Ein Lächeln war plötzlich auf seinem Gesicht. Er merkte, dass es sich von tief innen herstahl. “Die Glut ist noch da, aus der Funken sprühen”, sagte er. Dann zog er ihr Gesicht zu sich und sie küssten sich.
ENDE
© Jürgen vom Scheidt – geschrieben 15. Mai 1985