work in progress
Kategorie: Allgemeines
Der Älteste seiner Art
In jedem Beruf gibt es jemanden, irgendwo auf der Welt, der oder die selbst im hohen Alter noch aktiv ist. Zum Beispiel den Pianisten Jegal Sam – mit 96 Jahren noch immer in Südkorea aktiv. Er möchte “der älteste Klavierspieler der Welt werden”, erzählte er in einem Interview (s. unten).
Ich habe auch so einen Ehrgeiz: Ich möchte der “älteste publizierende Schriftsteller der Welt” werden. Da habe ich noch einige Konkurrenz vor mir, denn ich bin erst 80 Jahre alt. Jack Williamson zum Beispiel, ein bekannter amerikanischer SF-Autor, hat mit 98 noch eine Anthologie mit eigenen Geschichten veröffentlicht; kurz darauf starb er. Kein allzu gutes Omen.
Ernst Jünger (1895-1998), bekannter deutscher Autor, wurde 102 Jahre alt. Veröffentlicht hat er vor seinem Tod kaum mehr – “Weiße Nächte” erschien immerhin 1997, da war er schon 101 .
Mein Traum: 110 Jahre alt werden und noch veröffentlichen (vielleicht hier im Blog), wie ich dieses Jahr erlebe, über das ich 1992 in Psychologie heute einen Beitrag über den Homo futurus geschrieben habe. Ich wüsste zu gerne, wie dieses Jahr wirklich beschaffen sein wird. –
Hier ein Auszug des Artikels über den koreanischen Pianisten:
Da sitzt er am Flügel, ein kleiner Mann, den Blick in eine unbestimmte Ferne gerichtet. Beiges Jackett, schwarze Fliege. Er haut nicht in die Tasten, er streichelt sie. Das ist Jegal Sam, 96 Jahre, Pianist aus Südkaorea. Er möchte der älteste Klavierspieler der Welt werden, erzählt er der BBC, die einen Beitrag über ihn mit diesem Konzertmitschnitt einleitet. „Das Klavier und ich sind eins – wie kann ich ohne es leben?“ Seit 86 Jahren übe er täglich, 50 Jahre unterrichtete er, das, glaubt er, hat ihm das Leben gerettet: Er sollte zum Koreakrieg eingezogen werden, aber für Lehrer galt eine Ausnahme – auch für jene, die Klavierstunden gaben.
Quelle:
Linnartz, Mareen: “Klänge der Erinnerung”. In: Südd. Zeitung Nr. 03 vom 05. Jan 2021, S. 10 (Panorama)
Gibt es ein anschaulicheres Symbol für das Schreiben als das wundersame geflügelte Pferd, das die Griechen Pegasus nannten? Wie sich da ein doch recht schweres und schwerfälliges Geschöpf in immer entlegenere Höhen emporschwingt! Der allfällige Reiter muss allerdings die Zügel (einen “roten Faden”?) geschickt lenken, um das gesteckte Ziel seiner Phantasie und Kreativität in geistigen Höhen zu erreichen. Sonst geht es ihm / ihr wie dem unglückseligen Ikarus, welcher der Sonne zu nah kam. Seine künstlichen Flügel schmolzen – und er stürzte ins Meer und ertrank.
(In einer seltenen anderen Variante der Sage überlebt Ikarus allerdings – was wiederum darauf hinweist, welche unbändige Phantasie die Griechen hatten, wenn sie sich auf ihre Pegasi schwangen…)
1987 stellte der griechische Archäologe Nikolas Yalouris seinen opulenten Bildband zu diesem mythischen Tier vor: Pegasus: Ein Mythos in der Kunst.
Der Mythos ist inzwischen Jahrtausende alt, hat aber nichts von seinem tiefen Sinngehalt verloren. Ganz im Gegenteil: er ist noch immer ein höchst lebendiges Sinnbild der schöpferischen Kräfte im Menschen (wie sich u.a. in Träumen unserer Tage zeigt). Der Inhalt des Mythos und seine Entstehung werden ebenso behandelt wie kulturgeschichtliche und kreativitätspsychologische Aspekte: Die verborgene Bedeutung des Mythos wird interpretiert als Integration biologischer (d.h. triebhaft-sexueller) und spiritueller Kräfte.
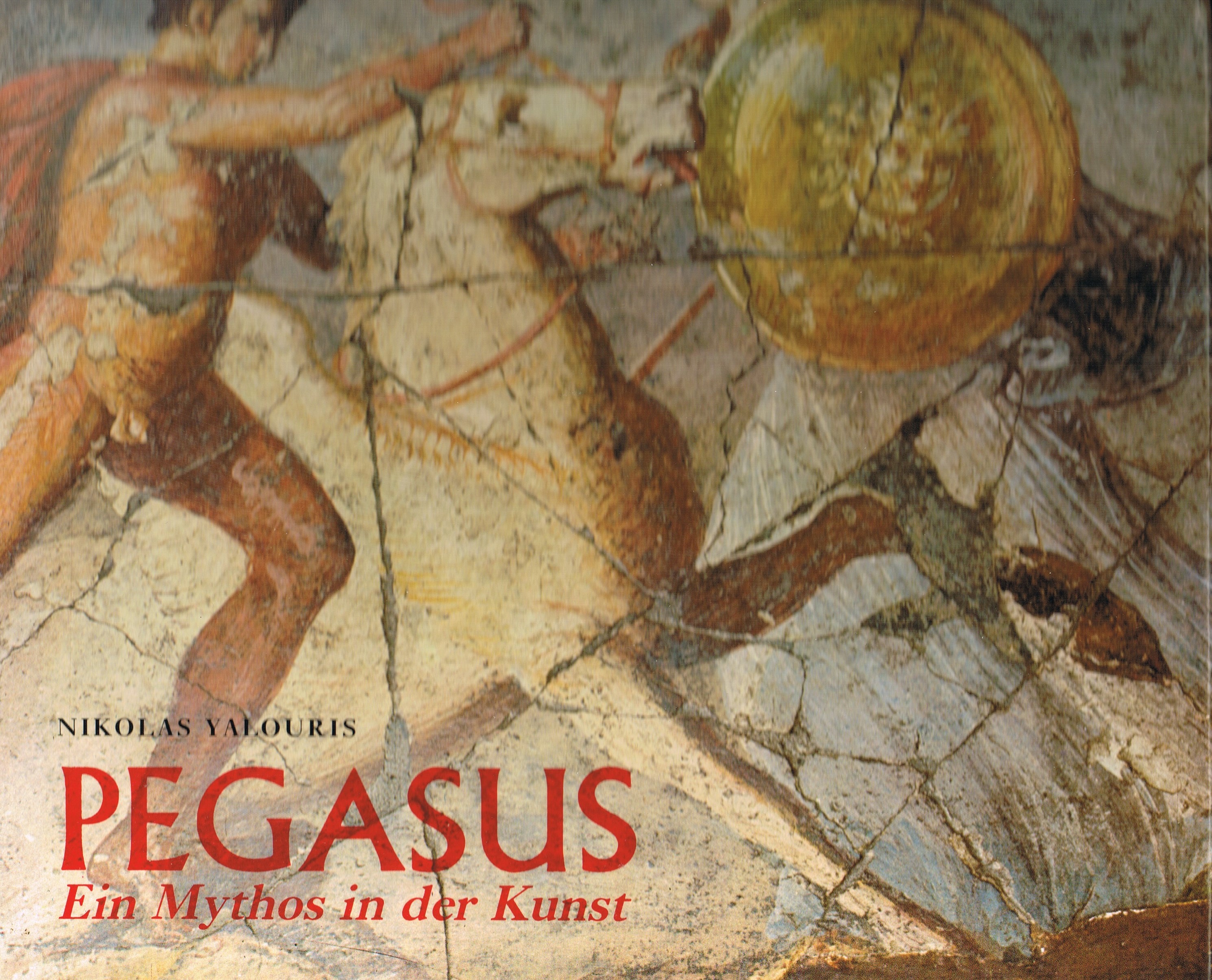
Ich war sofort fasziniert von diesem Stoff und nahm das Buch als Vorlage für eine Sendung, die am März 1988 im “Nachtstudio” des Bayrischen Rundfunks in den Äther ging: “Pegasus – das beflügelnde Wesen”.
Ein Verein – das wär´s!
Nachdem ich schon seit 1979 Seminare für Kreatives Schreiben durchführte, ging immer ständig die Idee durch den Kopf, einen Verein ins Leben zu rufen, der sich diesem Thema widmet. Yalouris´ Werk und meine BR-Sendung verliehen diesen Phantasien den entscheidenden Impuls, die Idee zu realisieren. Ich trommelte einige Schreibbegeisterte aus damaligen Seminaren zusammen und gründete mit meiner Frau Ruth den Verein, dessen Gründungsversammlung am 05. Okt 1988 war. Bei der Abfassung der Satzung half Norbert Engel, damals Justitiar im Bayerischen Senat und ebenfalls ein Schreibbegeisterter. Mein Graphikerfreund aus Jugendjahren Alfred Hertrich zeichnete das passende Logo. Einige Jahre war ich selbst Erster Vorsitzender des Vereins. Dann dachte ich irgendwann: Entweder mein Baby ist stark genug auch ohne mich als “Papa”- oder es geht ein.
Es war stark genug – denn der Verein, inzwischen bereits von der “vierten Generation” geführt und gepflegt, existiert nach wie vor. Er veröffentlicht jedes Jahr ein eindrucksvolle Anthologie mit Geschichten der Mitglieder (Weihnachten war die neueste Ausgabe bei mir im Breifkasten, herausgegen von Ute Lutsch und Nikol Schlichte und wieder sehr gelungen in der Mischung aus Kurzgeschichten, autobiographischen Memos und Gedichten.)
Der Verein hat längst eine eigene Website – www.pegasus.schreiben.de – und er wird auch die Corona-Pandemie in bewährter Kreativität und Phantasie überstehen, ist doch für den Schreibenden “alles Stoff” und so eine weltweite Katastophe sowieso.

2014 stellte die (inzwischen leider eingestellte) Zeitschrift TextArt anlässlich des 30. Geburtstags den Münchner Verein ausführlich vor. Inzwischen hat der Verein längst sein 35. Jubiläumsjahr gefeiert. Hier ein von der Website geklautes Szenebild aus der Lesung vom November 2019:

Die Wikipedia weiß noch mehr
Für alle, die zu faul sind, selbst in die Wikipedia zu schauen, zitiere ich hier, was dort über den Mythos von Pegasus (auch: Pegasos) zu lesen ist:
Pegasos war das Kind des Meeresgottes Poseidon und der Gorgone Medusa. Die Überlieferungen über seine Geburt variieren: Eine Version berichtet, er sei aus Medusas Nacken entsprungen, als diese von Perseus geköpft wurde. Hierbei sei er als Zwilling von Chrysaor zur Welt gekommen. Eine andere erzählt, er sei aus jener Stelle der Erde entsprungen, auf welche Medusas Blut getropft sei.
Pegasos trug Bellerophon in seinem Kampf gegen die Chimära und die Amazonen. Es gibt verschiedene Geschichten, wie Bellerophon Pegasos gefunden habe: So sagen einige, dass der Held ihn trinkend am Brunnen von Peirene (am „pirenischen Quell“) gefunden habe, andere berichten, dass entweder Athene oder Poseidon Pegasos zu Bellerophon führten. Bevor er Bellerophon beistand, brachte Pegasos Blitz und Donner zu Zeus, und nach dem Tod Bellerophons kehrte er zum Berg Olymp zurück, um den Göttern zu helfen.
Angeblich entstanden durch Pegasos’ Hufschlag zwei Brunnen: einer auf Geheiß von Zeus auf dem Gebirge Helikon (der „helikonische Quell“, aus dem alle Dichter trinken), ein zweiter in Troizen (vgl. auch Hippokrene).
Pegasos wurde in ein Sternbild verwandelt, aber eine Feder seiner Flügel fiel nahe der Stadt Tarsos zurück auf die Erde und gab der Stadt ihren Namen. Seine Ursprünge als Mischwesen sind vermutlich orientalischer Herkunft. Er wurde häufig in der kretischen und kleinasiatischen Kunst und sogar noch bis in das dritte Jahrhundert nach Christus auf römischen Münzrückseiten dargestellt.
Das mit der “Verwandlung in ein Sternbild” ist übrigens nur ein Beispiel dafür, wie das geflügelte Pferd die Phantasie seit vielen Jahrhunderten angeregt und sich in alle Beriche der Kultur und Zivilisation verbreitet hat. Es gibt:
° eine Schweizer Musikgruppe dieses Namens,
° eien amerikanische Rakete,
° einige Weltraumsatelliten dieses Namens,
° eine Drohne der Budneswehr,
° einen Computer,
° eine Schad-Software,
° einen Wirtschaftspreis (in Österreich),
° das Emblem als Bildmarke der Mobil Oil Company
° und , alst but noch least, einen “Pegasus Verein für kreatives Schreiben” in München – aber darauf habe ich ja oben schon hingeweisen.
Was letzteres angeht: Als ich 1989 den Verein im Münchner Vereins-Register anmeldete – gab es rund ein Dutzend Vereine, die diesen Namen führten, darunter einen für Oldtimer-Fans. Bewegung ist eben alles.
Lesefutter
Buslau, Oliver: “Eine Autorengruppe asu München stellt sich vor. In: TextArt Heft 4, April 2018, S. 52.
Scheidt, Jürgen vom: Pegasus – das beflügelnde Wesen. München 1988. Manuskript einer Sendung des
Bayr. Rundfunks im “Nachtstudio” am 15. März 1988.
Scheidt, Jürgen vom und Norbert Engel: Satzung des Vereins “Pegasus e.V.” vom 19. Jan 1989.
(Gründungsversammlung des Vereins war am 05. Okt 1988).
Yalouris, Nikolas: Pegasus: Ein Mythos in der Kunst. Mainz am Rhein 1987 (Zabern).
(Kategorien: Schreiben – Mythologie – Pegasus)
Der Archivar der Zukunft 2
(Teil 1 der Geschichte finden Sie hier Archivar der Zukunft. Und hier geht es weiter:)
„Institut für Zukunftsberatung“, murmelte er selbstvergessen, „noch nie davon gehört.”
Zumindest konnte er sich nicht daran erinnern, eine Meldung oder einen Bericht über dieses ominöse Institut in einer der Hängemappen abgelegt, pardon: eines der Tiere seines Zoos mit solcher Nahrung gefüttert zu haben. Vielleicht wurde er bei den Delphinen fündig, was hieß: bei den Futurologen?
Er zog die betreffende Mappe aus dem Hängekorb, blätterte die säuberlich aufgeklebten und chronologisch sortierten Clippings durch, deren jüngstes immer zuvorderst stand. Fehlanzeige.
Eine gewisse Verwirrung überkam ihn. Wie er es immer in diesem höchst unangenehmen Zustand zu tun pflegte, flüchtete er sich in Erinnerungen. Die andere Möglichkeit in so einem Fall wäre gewesen, im Archiv zu kramen oder noch nicht einsortierte Clippings einzusortieren oder unaufgeklebte aufzukleben oder unsignierte zu signieren oder obsolet gewordene, von den Zeitläufen überholte Einträge zu eliminieren. Aber an diesem verwirrenden Morgen erinnerte er sich. Da stieg er gewissermaßen in die inneren Archive seiner höchstpersönlichen Vergangenheit hinab. Er sah seinen Vater vor sich, im Wohn- und zugleich Arbeitszimmer. Tische, Stühle, Sofa, Schrank waren übersät mit wirren Häufchen von Briefen, Notizen und vor allem Zeitungsausschnitten.
Der Vater hatte wohl gerade den Raum verlassen. Das Fenster stand weit auf, mit Blick auf den See, den der Föhnsturm aufwühlte. Ehe der kleine Hiernymos die drohende Gefahr erkennen und die Tür hinter sich schließen konnte, war der Sturm durch den Raum gefaucht, hatte sämtliches Papier hochgewirbelt und wie ein riesiger Staubsauger das meiste davon hinaus ins Freie gerissen. Er rannte, den Knall der Tür noch im Ohr, zum Fenster, starrte hinaus auf das weiße Gewimmel, das wie ein Schwarm seltsam flacher Möwen den schorfigen Abhang hinabsegelte und sich auf die wildschäumenden Wogen senkte. Die Schläge, die er als Belohnung für seine damalige Unachtsamkeit empfangen hatte, schmerzten ihn heute noch.
Angestrengt zwang sich Dr. Pigertaber, die Vergangenheit wieder loszulassen und in die Gegenwart zurückzukehren. Er wußte, warum er Archivar geworden war, wußte es in diesem Augenblick ganz genau. Er wollte beweisen, daß er mit ausgeschnittenem Papier sorgsam umgehen konnte und vor allem: daß er es, ordnend und zielstrebig, besser konnte als sein Vater.
Er hatte schon bald nach dem unliebsamen Zwischenfall, kaum in der Pubertät, begriffen, daß sein Vater in all dem Papier nach etwas suchte, vor allem in den kopierten Seiten aus Büchern, die er gerade las, und in den Zeitungsausschnitten. Aber wonach suchte er?
Nach irgendwelchen geheimnisvollen Zusammenhängen? In einem Puzzlespiel, dessen Entwurf ihm, dem Sohn, nicht bekannt war? Der Vater hatte nie darüber gesprochen. Und als Pigertaber nach seinem Tod die Papiere sichtete, in der Hoffnung, Aufschluß zu finden, Hinweise, vielleicht sogar des Rätsels Lösung, hatte er bald frustriert erkennen müssen, daß es vermutlich gar keine Lösung gab. Nicht einmal ein Rätsel. Der Vater war wahrscheinlich einfach ein von seinem Schnippelzwang besessener Neurotiker gewesen.
In einem Anfall von Wut hatte Pigertaber junior (wie er eine Weile hieß) damals die ganzen Fetzen dieser nutzlosen väterlichen Existenz vernichtet – um dann Jahre darauf, während seines Studiums der Philosophie, plötzlich zu entdecken, daß er selbst die Marotte des Sammelns von Informationen entwickelte. So wie der Vater vom Verkauf von Büromöbeln den Lebensunterhalt der Familie bestritt und seine ganze freie Zeit den Papieren widmete, so lebte er, der Sohn, vom Verkauf von Computern. Bis die unverhoffte Erbschaft von einem fernen Verwandten ihn von dieser Fron erlöste.
Es war nicht lange danach (seine Frau und die Kinder hatten ihn mit der Hälfte der geerbten Beute längst verlassen), als er doch noch das Geheimnis des Vaters enthüllte. Weil er es bei sich selbst wiederfand. Er sammelte all diese Informationen zunächst einem dunklen, völlig unbewußten Trieb folgend. Aber es gab auch eine zunehmend bewußter werdende Komponente bei all der dranghaften Aktivität, die sich durch nichts bremsen ließ: Er erhoffte sich davon, dem Sinn der Welt auf die Spur zu kommen, der Handschrift, der persönlichen Signatur des Weltgeistes gewissermaßen, der sich – so seine immer klarer werdende Gewissheit – auf irgendeine Art in den Ereignissen dieser Welt manifestierte.
Und wenn man die Nachrichten über diese Ereignisse zusammentrug, wenn man es schaffte, sie richtig zu analysieren und schließlich auf passende Weise miteinander in Beziehung zu setzen, dann würde ihm, dessen war er sich gewiss, die Botschaft des Weltgeistes und damit zwangsläufig auch der Sinn der Welt enthüllt. Und damit auch der Sinn seines eigenen kleinen Lebens.
Diese stickige, staubige Luft in dem engen Raum! Er stürzte zum Fenster hin und riß beide Flügel weit auf. Draußen tobte der Föhnsturm, wühlte das schmutziggraue Wasser des Sees auf. Zwei Möwen segelten mit spitzen Schreien dicht über die Gischt.
Die Tür, durchfuhr es ihn, er hatte die Tür nicht geschlossen! Wie damals, mehr als dreißig Jahre zuvor!
Der Föhnsturm tobte herein, packte jedes lose Blatt, riss sogar die Hängemappen aus den Hängetrögen, leerte ihre sorgsam sortierten Clippings hohnvoll in den Raum, riss sie dann in wilden Tänzen hoch. Spiralen aus flatterndem Weiß erhoben sich, mit Druckerschwärze gesprenkelte Vogelschwärme, die ihn wild umkreisten, mit spitzen Krallen nach ihm schlugen und endlich in wahnwitziger Flucht hinaus ins Freie tobten, über den Steilhang ins zuckende Brodeln des Sees.
Ach, wenn es doch so wäre, durchzuckte ihn ein Gedanke aus rebellischen Tiefen. Doch er versiegelte sogleich wieder den Abgrund, den die Erinnerung aufgerissen hatte, schloss das Fenster wieder und ließ den erschrockenen Blick, der langsam ruhiger wurde, über die verschlossene Tür gleiten, über die wohlgefüllten Regale mit ihren sorgsam in Klarsichtfolie verpackten bunten Buchrücken, über die Straßen mit Hängetrögen, in denen die Hängemappen-Hundertschaften ihre Clippings bargen, Tausende und Abertausende von ihnen.
„Alles in Ordnung“, seufzte er. In den Käfigen regte es sich schon und verlangte unruhig nach Nahrung. Steif bückte Dr. Hieronymos Pigertaber sich zu dem einen weißen Blatt herab, das am Boden lag und vorhin seinen Händen entfallen war. „Institut für Zukunftsberatung“ lasen seine kurzsichtigen Augen in grünen Buchstaben. Es war ein zartes Grün, das man Reseda nannte. Der Text unterhalb des dezenten Briefkopfes war in schwarzer Schrift gehalten, wahrscheinlich vom Drucker eines Computers hergestellt. Aber es war eindeutig ein persönlicher Brief, keine Dutzendware. Er begann zu lesen:
Sehr geehrter Herr Doktor Pigertaber:
Wir würden gerne persönlichen Kontakt mit Ihnen aufnehmen betreffs Ihres vielgerühmten Archivs. Wir befassen uns, wie Sie dem beigefügten Programm entnehmen können, mit einer neu entwickelten Disziplin, dem „Zukunfts-Management“, in dem wir sowohl Führungskräfte wie auch andere interessierte Personen mit der Möglichkeit einer bewußteren Gestaltung ihrer beruflichen und privaten Zukunft vertraut machen. Besonderes Gewicht legen wir dabei, wie Sie den einzelnen Seminarbeschreibungen entnehmen können …
Es folgten etwas umständliche Ausführungen über die unbedingt nötige Balance zwischen den Fähigkeiten der beiden Gehirnhälften, nämlich sich auf die Zukunft sowohl rational analysierend wie auch intuitiv-visionär vorzubereiten. Kopfschüttelnd las Pigertaber weiter, dem selben Zwang folgend, der ihn auch keinen einzigen Zeitungsartikel aus der Hand legen ließ, ehe das letzte Wort von seinem Gehirn aufgesaugt war. Als er den abschließenden Absatz studiert hatte, fühlte er sich mehr verwirrt als aufgeklärt:
Hierbei ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, möglichst fundiertes Wissen um die laufenden Trends, positiver wie negativer Natur, unerlässlich. Wir stellen uns vor, daß Ihr Archiv und vor allem Ihr persönliches Wissen, das Sie in diesem Archiv gespeichert haben, für unsere Seminare von unschätzbarem Wert wären. Deshalb würden wir uns über eine Zusammenarbeit, in welcher Form auch immer, sehr freuen.
Für einen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte, Ihr eigenes Interesse vorausgesetzt, an unsere Mitarbeiterin, Frau Marlies Weber-Schindler.
Mit vorzüglicher Hochachtung verbleibe ich
Dr. Justus Hohrainer, Direktor IfZF
Pigertaber ließ den Brief sinken, legte ihn langsam auf den langen Schreibtisch aus schwarz gebeizter Eiche. Eine Möglichkeit, sein Archiv tatsächlich zu nützen – davon hatte er immer geträumt, hatte dieser Möglichkeit aber nie eine echte Chance eingeräumt. Und nun war es tatsächlich soweit! Es war unfassbar. Eine gewisse Verwirrung überkam ihn. Als er nach einer Weile wieder zu sich kam, kratzte er sich nachdenklich am Kopf, der in all den Jahren nahezu kahl geworden war vom vielen Nachdenken und Archivieren. Langsam gruben seine Finger in seinen Taschen nach Streichhölzern. Dann holte er den Kanister mit Benzin, den er für diesen Fall der Fälle vorbereitet hatte, vor vielen Jahren schon. Sorgsam goss er die scharf riechende Flüssigkeit über den Käfigen und Aquarien aus, dem rebellischen Fauchen und Brüllen der Eingeschlossenen zum trotz. Er entzündete ein Streichholz, ein einziges nur, und ließ es über dem Areal der Raubtiere fallen.
Er öffnete erneut das Fenster. Dann ging er, das flotte Knistern im Rücken, zur Tür hinaus, zum Haus hinaus, auf die Straße. Der Föhnsturm rüttelte an seiner Jacke, bis er sie befreit von sich warf. Immer weiter lief er die Straße entlang. Den nächsten Hügel hinauf und hinab. Bog in einen Weg durch Äcker ein. Lief den nächsten Hügel hinauf. Hinab. Bis er in die Wälder kam. Nicht ein einziges Mal wandte er den Blick zurück.
(Geschrieben am 05. Juni 1990 / Erstmals abgedruckt Mai 2005 in meiner Anthologie Blues für Fagott und zersägte Jungfrau. –
04. Januar 2021: Gewidmet meinem Vater, der mich mit seiner Schnippelei ähnlich aufgeregt hat – wie ich später meine Frau Ruth, als ich selbst dieser “Schnippel-Manie” verfallen war – deshalb auch ihr gewidmet mit einem großen: “Tut mir leid, dass ich dich damit genervt habe. Aber…”)
Zeitung lesen – Thesauros füttern
Sie denken, dazu muss man doch nicht extra was bloggen: Zeitung lesen. Das macht man doch einfach so. Aber ich kann nur sagen, dass das viele Menschen zwar gewohnt sind – aber manche eben nicht. Als Student habe ich mal bei einer Messe gejobbt. Bei einer der Pausen kam ich an einem Würstchenstand mit dem Würstlbrater und seiner Frau ins Gespräch – “einfach Leute”, wie man so sagt. Auf ihre Frage nach meinem Beruf (“Student der Psychologie”) kam von dem Mann die Antwort: “Da müssen sie aber viele Bücher lesen – das wär nix für mich – ich krieg schon Kopfschmerzen, wenn ich die Bildzeitung lese.”
Aber ich will auf was anderes raus. Normalerweise lesen Sie Ihre Zeitung – und werfen diese dann in den Papiermüll. Ich lese ganz anders.
Zum einen: Für mich ist Zeitunglesen Teil meiner täglichen Arbeit. Das ist meine Form des “Lebenslangen Lernens” und der Fortbildung (sollte man auch mit 80 noch ernsthaft betreiben – man weiß ja nie – wie alt man noch wird).
Zum anderen: Ich lese die Süddeutsche von hinten nach vorne und zwar sehr rasch. Ich scanne gewissermaßen erst den Bayern-Teil, dann den Lokalteil, die Beiträge zu den Stadtteilen, dann den München-Teil.
Das heißt: Zuallererst durchfliege ich rasch den Sport – nicht, weil mich Fußball oder dergleichen besonders interessiert (über Judo lese ich gerne was, weil ich selber mal trainiert habe). Aber im Sport-Teil suche ich nach Schlagzeilen, in denen der Begriff “Entschleunigung” vorkommt – ist so eine Marotte von mir. Habe ich tatsächlich schon zweimal entdeckt, obwohl es beim Sport doch eigentlich immer ums Gegenteil geht: möglichst schneller zu rennen, oder höher, weiter zu springen – Rekorde zu brechen – also zu beschleunigen.
Wenn ich so etwas entdecke (kommt eher im Wirtschaftsteil oder im Feuilleton vor oder in der Politik), schneide ich den Artikel erst einmal aus. Richtig gelesen wird das alles in Ruhe später; das sind meistens an die zehn Artikel oder so.
Der dritte Schritt ist schon aufwändiger: Ich füge Clippings, die mich wirklich interessieren, meinem Archiv ein.
Ich habe meinem Vater früher irritiert zugeschaut, wenn er etwas aus der Zeitung “schnippelte” (wie der Rest der Familie das abschätzig nannte). Irgendwann warf er die Schnipsel weg. Und begann anderntags bei einer neuen Zeitung von vorne. Das erschien mir irgendwie so sinnlos. In seinen Kopf konnte ich ja nicht reingucken. Ich hätte als Schülern nicht im Traum gedacht, dass ich das später ähnlich machen würde. Nur hatte ich da schon ein Archiv, in dem ich diese Zeitungsausschnitte nach Themen geordnet in Hängemappen einsortierte, zur allfälligen Verwendung bei einem der Text-Projekte, die ich bearbeitete. Das war gewissermaßen außer meinen eigenen Gedanken und Recherche-Ergebnisse wie Zitaten aus Büchern anderer Autoren, so etwas wie mein Rohmaterial – Bausteine für die papierenen Gebäude, die allmählich Gestalt als Buchmanuskripte annahmen. Wenn es gut ausging. Vieles war natürlich irgendwann veraltet oder sonstwie überholt, wahrscheinlich sogar das meiste. Aber das weiß man ja vorher nicht. Jedenfalls häuft sich da doch aus der Zeitungslektüre allmählich einer richtiger Schatz an Informationen an – weshalb man so ein Hängemappen-Archiv zu Recht als “Thesauros” bezeichnet, was, aus dem Griechischen stammend , wörtlich heißt: “Schatz aus Gold”. Das erste Mal sah ich so einen “Goldschatz” (in Form von an die tausend Hängemappen in einem großen Registerschrank) im Forschungsinstitut des Biokybernetikers Frederik Vester. Tief beeindruckt wusste ich bald: Sowas will ich auch mal haben. Habe ich auch inzwischen. Mit tun nur meine Nachkommen leid, die das alles nach meinem Tod entsorgen müssen. Aber das ist deren Problem – ich schnipple weiter und sammle und archiviere – und verstehe meinen Vater ein wenig besser.)
Wie so eine Clipping-Manie in Extremform aussehen könnte, das habe ich in einer Kurzgeschichte dramatisiert. Sie ist enthalten in meiner Anthologie Blues für Fagott und zersägte Jungfrau und hat den Titel: Der Archivar der Zukunft“.
Der Archivar der Zukunft 1
Seien Sie bitte nicht enttäuscht, wenn ich Ihnen hier nur den Anfang dieser Kurzgeschichte anbiete – gewissermaßen als Appetithappen. Aber den Rest der Geschichte finden Sie in meiner Anthologie Blues für Fagott und zersägte Jungfrau (Enttäuscht? Dann schaue Sie bitte an den Schluss dieses Beitrags!). Und so fängt sie an:
Dr. Hieronymos Pigertaber betrat das Archiv, wie jeden Morgen. Es war sein Archiv. Für sich hatte er es eingerichtet, vor vielen Jahren. Nur für sich, ganz seinen Neigungen und Interessen folgend. Eine Zeit lang war er verheiratet gewesen, hatte drei oder vier Kinder gehabt (er wußte das nicht mehr so genau, es war schon einige Jahrgänge der Süddeutschen Zeitung und anderer Journale her, die er auswertete). Aber Frau und Kinder hatten ihn irgendwann verlassen, und er war – nach anfänglicher Bestürzung über das plötzliche Alleinsein – mehr und mehr froh darüber, sich ganz der Fütterung und Dressur seines Archivs widmen zu können.
Ja, so nannte er es bei sich: Fütterung und Dressur. Das Archiv war in den Jahrzehnten zu einer Art Zoo geworden. Jedes der Themen, für die er Material, nein: Nahrung sammelte, war einer Tiergattung zugeordnet. Da gab es zum Beispiel die gefährlichen Themen: Unfallgefahren, Aids und andere schreckliche Krankheiten, Erdbeben, Terrorismus, Krieg und Revolution. All das eben, wovor er Angst hatte.
Die Hängemappen, in denen er solches säuberlich signiert, datiert und auf weiße DIN A 4-Blätter aufgeklebt verwahrtee, trugen nicht nur kleine weiße Schildchen in durchsichtigen Plastikreitern, auf denen „Atombombe” und „Tsunami” und „Amoklauf” und „Kriminalität” stand – nein: Sie trugen auch noch eine heimliche Bezeichnung, die nirgends notiert war, eine Bezeichnung, die nur sein Gehirn kannte.
Terrorismus zum Beispiel, das war der Tiger. Und wenn er eine schreckliche Meldung über die weitere Eskalation des Kokainmissbrauchs in den USA oder in der Bundesrepublik fand, dann fütterte er damit den Weißen Hai. Berichte über die Mafia landeten bei den Kobras, eine bewaffnete Invasion von PLO-Freischärlern in Israel oder von israelischen Soldaten im Libanon war Leibspeise der Elefanten.
Machten die Sowjets etwas Schreckliches in Afghanistan oder die Briten auf den Falkland-Inseln oder die Amerikaner im Irak, so warteten bereits die Wale auf ihr Futter. Noch größere Tiere gab es nicht in seinem Zoo. (Die gab es nur in seiner Phantasie – und wie es sie dort gab!)
Dafür gab es jede Menge kleinere Tiere. Zum Beispiel die Piranhas! Das waren zum Beispiel Autofahrer, die betrunken kleine Kinder oder alte Leute an Zebrastreifen und in 30-Kilometer-Zonen überfuhren. Eines seiner Lieblingstiere, unablässig mit Kohlblättern gefüttert, war die Napfschnecke. In der mit ihrem Namen versehenen Hängemappe wurde alles archiviert, was Politiker Bemerkenswertes von sich gaben und entschieden, vor allem aber die Fettnäpfchen-Akrobatik eines ehemaligen Bundeskanzlers.
An dem Morgen, als Dr. Hieronymos Pigertaber zum tausendsten Mal die „Papierwüsten“ betrat (wie er das Archiv in einem Anflug von sarkastischer Selbstkritik auch schon mal nannte), da war etwas anders geworden. Er hatte einen Auftrag bekommen. Ein „Institut für Zukunftsberatung“, von dem er noch nie zuvor etwas gehört hatte, machte ihm ein Angebot. Er wußte nicht, wie sie ausgerechnet auf ihn gestoßen waren unter all den vielen möglichen Archivaren.
„Institut für Zukunftsberatung“, murmelte er selbstvergessen, „noch nie davon gehört.”
(Neugierig geworden, wie es weitergeht? Die Fortsetzung finden Sie meiner Anthologie Blues für Fagott und zersägte Jungfrau – München 2005, Allitera-Verlag. Als Paperback und als E-Book jederzeit lieferbar.
Aber ich will nicht gemein sein und Sie in Kosten stürzen.Weil sie brav meienr Erzählung bis hierher gefolgt sind, finden Sie den zweiten Teil der Geschichte auch hier im Blog: Archivar der Zukunft (Forts.) )
Das Kind Der Krieg Der Tod
In Leipzig am 07. Februar 1940 geboren, verbrachte ich dort die ersten beiden Lebensjahre mit meiner Mutter und dem Kindermädchen Else in einer Mietwohnung am Wangerooger Weg 3. Mein Vater war im Krieg – wie fast alle Männer. 1942 wurden die Bombenangriffe auf die Stadt immer heftiger, sodass meine Mutter sich entschloss, diese Wohnung zu verlassen und zurück in ihren früheren Wohnort Rehau zu gehen, zu ihren Eltern. Man nannte dies damals Evakuierung.
Ob dieses Portrait von mir noch in Leipzig oder schon in Rehau angefertigt wurde, ist unbekannt. Die Künstlerin, Irene Born, war mit der Schwester Elisabeth (“Lis”) meiner Mutter befreundet. Tante Lis machte damals eine Schreinerlehre in Rehau und lebte deshalb ebenfalls in der Wohnung ihrer Eltern.

Was die Datierung dieses Bildes angeht, so gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Zum einem mein zweiter Geburtstag am 07. Februar 1942 – oder vielleicht als Geschenk der Schwester Lis Hertel an meine Mutter Marie vom Scheidt, geb. Hertel, zu deren 28. Geburtstag am 19. Februar 1942.
Aufgewachsen im Matriarchat
Warum ich dieses idyllische Bild hier präsentiere? Weil es so etwas wie die friedliche Oberfläche von etwas völlig anderem darstellen. 1942 war der Zweite Weltkrieg in vollem Gange, angezettelt von Diktator Adolf Hitler und seinen nationalsozialistischen Mörderbanden. Ich bin in Rehau aufgewachsen in einem Haus, in dem sieben Frauen lebten und das Leben am Laufen hielten: Im Ersten Stockwerk meine Mutter Marie, deren Schwester Elisabeth, beider gemeinsame Mutter Betty Hertel (geb. Kropf). Im zweiten Stock die Frau Annemie von Onkel Karl (dem Bruder meiner Mutter und von Tante Lis) und Annemies Mutter, die “Omi Unglaub”. Unten im Hauseingang hatte das Dienstmädchen Else ihr Zimmer und ab und zu kam ein Kindermädchen (?), das mich spazierenfuhr. Und dann lebte im Erdgeschoss. neben dem Architekturbüro des Großvaters, noch die Frau Funke, ähnlich alt wie Großmutter. Ich liebte sie sehr und wollte immer bei ihr sein, rief “Unke, Unke”, wenn ich zu ihr wollte – einmal zu schnell, denn ich stolperte und stürzte kopfüber die Treppe aus hellgrauem Granit hinunter – hat meinem biegsamen Kinderkörper und meinem Kopf aber wohl nichts geschadet. Ich habe also schon sehr früh das “Fallen” gelernt und konnte da als Student dann im Judotraining bei den Fallübungen von Judoka Aigner gut anknüpfen – was mir noch später bei diversen Stürzen mit dem Fahrrad sehr geholfen hat – zuletzt vor zwei Monaten, da war ich schon achtzig – aber das Fallen kann ich offenbar immer noch recht geschickt…
<p>Und wo waren all die Männer? Natürlich waren sie “im Krieg” zu jener Zeit – oder sollte ich besser schreiben: “unnatürlich”? Mein Vater, Onkel Karl und sogar mein Großvater (der schon im Ersten Weltkrieg in der größten Scheiße gekämpft hatte: in Douaumont bei Verdun) waren irgendwo dort draußen “an der Front”. Mein Vater kämpfte damals vermutlich in Holland, Onkel Karl und Großvater in der Ukraine.
WAS HATTEN DIE DEUTSCHEN SOLDATEN DORT ZU SUCHEN?!
Mein Großvater Karl Hertel, Jahrgang 1880, meldete sich als aktiver Offizier im Majorsrang 1941/42 freiwillig erneut zum “Dienst an der Waffe”. Er mochte diesen “Anstreicher” nicht, diesen Gefreiten Adolf Hitler (im Gegensatz zu meinem Vater, der als junger Mann ein “glühender Nazi” gewesen ist). Aber er war loyaler Bürger. Und er war
° zum einen lieber Soldat als Architekt und er war als Offizier der Reserve und als Mitglied des deutschnationalen Stahlhelm ein echter Untertan, der tat, was man ihm befahl;
° und zum anderen ertrug er nicht das schreckliche Sterben seiner todkranken Frau Betty, die an Magen, Brust- und Kehlkopfkrebs litt .
Dann schon lieber das Sterben an der russisch-ukrainischen Front (wie mir Tante Lis Jahrzehnte später einmal als den wahren, tieferen Grund seiner Teilnahme an diesem zweiten Weltkrieg plausibel machte).
<Großvater in der Ukraine>
Seltsam: Der Großvater läuft vor dem Sterben seiner Frau davon – der Enkel (ich) muss das miterleben. Ich habe an Sterben und Tod meiner Großmutter keinerlei Erinnerungen. Sie starb Ende 1942 qualvoll, weil es kaum schmerzlindernde Medikamente gab (es war ja Krieg mit Mangelwirtschaft), gepflegt von ihren Töchtern. In ihrem Schlafzimmer in der selben Wohnung, wo ich im Zimmer nebenan spielte.<br>An Sylvester 1942 starb noch jemand in diesem Haus: mein Cousin Heinz Hertel, mein bester Freund “Heinzele”. Er starb, weil die Frauen irgendwoher echten Bohnenkaffee aufgetrieben hatten und den zum Jahreswechsel unbedingt trinken wollten. Heinzele wollte auch “Kaffee” und bekam ihn. Eine rätselhafte Reaktion seines Blutes reagierte tödlich auf das Coffein – er starb in den nächsten Tagen*.
* Makabre Auswirkung: Wie Onkel Karl, Heinzeles Vater, mir viele Jahre später einmal erzählte, hat ihm der Tod des Ersdtgeborenen damals vermutlich das Leben gerettet. Er bekam nämlich zur Beerdigung Heimaturlaub – als er in die Ukraine zu seinem Batallion zurückkehrte, war dieses vom russischen Gegner fast völlig vernichtet worden.
Ja, der Tod war sehr präsent im Haus Bahnhofstraße 15 in Rehau in meinem zweiten Lebensjahr. Indirekt war er zudem sicher ständig gegenwärtig in der Sorge und den Ängsten der Frauen um ihre Männer draußen irgendwo in Europa im Krieg.
Habe ich die Bombenangriffe in Leipzig miterlebt? Wenn später, in den 50er Jahren, am Mittwoch um 12:00 Probealarm war, fuhr mir das immer durch und durch. Ich habe den Fliegeralarm während des Krieges sicher auch in Rehau immer wieder mit erlebt. Dort wurde nie bombardiert – aber die Bomberschwärme der Alliierten flogen hoch oben am Himmel über den Ort – Richtung Berlin, Dresden. Leipzig – oder nach München.
Rehau war den ganzen Krieg über eine Idylle. Wäre nicht im Mai 1945 noch im letzten Augenblick von einem amerikanischen Panzer die Roth´sche Holzwollfabrik am Hofer Berg in Brand geschossen worden – Rehau hätte keinen einzigen Kratzer in diesem Krieg abbekommen.
Aber in meinen Träumen jener Kriegstage in Rehau muss ich mitten drin gewesen sein in fdiesem Inferno. Meine Mutter ging gerne ins Kino, in “Lichtspieltheater” vom Otto Strobel. Doch einmal musste man sie mitten aus der Vorstellung nachhause holen, weil ich vom Kindermädchen nicht zu beruhigen war und nicht aufzuwecken aus einem Albtraum, in dem ich von brennenden Häusern und von den “Fiechern” phantasierte – meinem Kinderwort für die Flieger, die ihre schreckliche Fracht oben am Nachthimmel transportierten.
(work in progress)
Anführer sein
Als Seminarleiter bin ich naturgemäß das, was man als “Anführer” einer Gruppe bezeichnet. Was einen guten Anführer auszeichnet, habe ich im Sommersemester 1962 als Student bei Frau Dr. Neuwirth in der Vorlesung “Methoden der empirischen Sozialforschung” gelernt. (Ja, ich habe mein Archiv gut in Schuss.) Es stand in dem Buch The Human Group von George C. Homans.
Der Beitrag, der mich darin, vor allem beeindruckte, handelte von einer Jugendgang und wie deren Anführer seinen Status bekam und erhielt: Wenn die Gruppe zum Kegelspielen ging, war er nicht etwa der beste Kegler, und schon gar nicht immer, sondern er spielte im Mittelfeld – nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Es war diese Kontinuität, bei der er den besten Keglern der Gruppe den Vorrang ließ – aber doch seine Kompetenz zeigte und das über einen längeren Zeitraum. Solche Leute sind in Kleingruppen beliebt, weil sie zwar selbstbewusst sind und sich etwas trauen (“gute Kegler”) – aber sich nicht ständig egomanisch vordrängeln (wie ein gewisser amerikanischer Präsident, der endlich abgewählt wurde und dessen Namen ich nicht mehr nennen will).
Als ich diese empirische Studie in diesem Buch las, wurde mir etwas bewusst, was ich selbst als Kind falsch gemacht habe. Wenn es raus in den Wald zum Spielen ging, wollte ich immer der Anführer sein. Die Wünsche der anderen in der Gruppe waren mir egal – war ich doch “der Enkel vom Architekt Hertel” mit entsprechendem Selbst- und Elitenbewusstsein. Das kam bei den anderen Kindern nicht immer gut an. Darüber gab es sogar echten Streit und teils heftige körperliche Auseinandersetzungen. Im Verlauf einer dieser Rangeleien haute ich etwa 1950 (also zehnjährig) wutentbrannt meinem aktuellen Rivalen (Dieter Wiltscheck, ein Flüchtlingskind) meine martialische Anführer-Keule über den Schädel – und rannte davon. Dieter musste einige Tage das Bett hüten, mit einer mords Beule am Kopf und entsprechenden Schmerzen. Und ich musste bei der Flüchtlingshalbfamilie antreten (Mutter und zwei Halbwaisen, der Vater im Krieg gefallen) und mit einem großen geräucherten Schinken und verlegen gemurmelten Entschuldigungen Abbitte leisten. Die Entschuldigung wurde mir gewährt – was sonst sollte eine Flüchtlingsfamilie in einem Ein-Zimmer-Notquartier über dem Rehauer Lichtspieltheater sonst tun.

Ein andermal ging es ähnlich brutal zur Sache, etwa zwei Jahre später. Ein Nachbarjunge (Wolfgang Sack, ein Jahr älter als ich) machte mir wieder den “Anführer” bei irgendeinem der vielen Spiele unter Nachbarkindern streitig. Wutentbrannt (den Jähzorn habe ich astrein von meinem Vater geerbt oder abgeguckt) packte ich ihn und rieb seinen Kopf an einer einem rauhverputzten Mäuerchen neben der Städtischen Sparkasse rauf und runter, bis seine Schwarte blutete. Dann rannte ich davon. Die anderen brüllend hinter mir her. Ich mit einem großen Schwung aufs Schuppendach vom Bauhof meines Großvaters Hertel (ja, eben der) und von oben auf meine Verfolger heruntergeifernd und spottend. Als mir Klaus Schenk bedrohlich nachkommen wollte, warf ich ihm in meiner Not von oben (aus gut zwei Metern Höhe) einen Ziegelstein auf den Schädel, der da zur Beschwerung der Dachpappe lag. Was für ein Massel hatten wir beide, dass ich ihn dabei nicht totschlug – da hätte nur die Kante des Ziegels seine Fontanelle treffen müssen!
So kam er mit heulender Blessur davon – und ich zog ab. Da hat nie ein Erwachsener eingegriffen; sein Vater war immerhin Rechtsanwalt. Heute stünde so etwas (und noch so mancher andere Bubenstreich, von dem ich vielleicht ein andermal berichte) auf der Titelseite der Bildzeitung. (Wie der Vorfall, als wir den Lehrer des Schuldirektors Lange an den Marterpfahl banden und mit unseren feststehenden Messer nach ihm warfen – hat er auch überlebt, mit einer blutenden Fleischwunde an der Wade – der Vorfall wurde nie zur Sprache gebracht. Doch darüber vielleicht ein andermal mehr – weil das auch so ein Lehrstück in Sachen “Coming of Age” war.)
Mit Klaus Schenk hat sich nach diesem Vorfall übrigens eine lang anhaltende Freundschaft entwickelt. Wir machten ausgedehnte Spaziergänge in der Umgebung von Rehau, philosophierten über Gott und die Welt und trösteten uns gegenseitig über unsere Migräneattacken. Klaus, ein Jahr älter, hat mir 1954 die Tür zum Jazz aufgemacht – mit der Füllschriftplatte “Woody´ín with Woody” von Woody Herman and his Herd. Was für eine großartige musikalische Welt hat sich mir da geöffnet und ist mir bis heute, 66 Jahre später, erhalten geblieben.
Solche Erlebnis haben mir nachhaltige Lektionen erteilt. Die wurde allerdings erst sehr viele Jahre später wirksam, als ich während der TZI-Ausbildung begriff und mühsam lernte, wie man sich in Gruppen “anständig” und vor allem erfolgreich verhalten muss, wenn man ein echter Anführer sein will: Nämlich sich vor allem um die Belange der anderen zu kümmern und die eigenen Belange (ein wenig) zurückzustellen. Als Leiter der Gruppe immer auch Teilnehmer zu sein – und den Teilnehmern immer wieder Leiterfunktionen zu überlassen. Meine Frau Ruth war diesbezüglich ein Naturtalent – ich musste mir erst den “Enkel vom Architekt Hertel” abschminken. Aber in mehr als tausend Seminaren habe ich das Üben können.
Bibliographie
Hermann, Woody (Woodrow Charles Herman ): Woody´in with Woody (das muss eine Auskoppelung auf Füllschriftplatte aus der Longplay “Men from Mars” von 1954 oder “Swinging with the Woodchoppers” von 1950 gewesen sein).
Homans, George C.: The Human Group. (1950).
Weihnachten – zuende gedacht
Wir Erwachsenen in der Familie schenken uns schon lange nichts mehr. Geschenke sind für Kindern – und auch die sollte man nicht mir einer Überfülle traktieren. Ich selbst kann mich noch gut an die Nachkriegszeit erinnern, als es kaum das Notwendigste zum Überleben gab und man sich über ein Buch und ein paar Plätzchen und den alljährlichen Stollen freute und über einen leckeren Gänsebraten…
Obwohl 1: Fleisch essen ist ja nicht mehr so angesagt. Und wenn ich auf einer Speisekarte das Wort “Lammbraten” lese, kann ich mir nicht helfen: Ich sehe die Lämmer auf einer Wiese im Wallis hüpfen und mir dreht es den Magen um, das zu Ende zu denken. Bei einer Gans ist das Mitgefühl nicht gans so groß…
Obwohl 2: Ich bin mir bewusst, dass es müßig ist, den jüngeren Generationen was “vom Krieg” zu erzählen. Ein Besuch bei syrischen Flüchtlingen in einer Notunterkunft könnte dem allerdings leicht auf die Sprünge helfen – oder eine Doku im Fernsehen über das zerbombte Aleppo oder Mogadischu oder Kabul unserer Tage. Dort sieht nämlich heute genauso aus wie 1945 in München und Würzburg und Berlin und Dresden und Hamburg…
Es ist auch totaler Blödsinn, die aktuelle Corona-Pandemie mit einem Krieg zu vergleichen oder gar mit dem Zweiten Weltkrieg mit seinen 55 (65?) Millionen Todesopfern. Nicht nur deshalb, weil die Zahl der Opfer damit verglichen sehr gering ist und wir ja eine unglaublich fixe und tüchtige Pharmazie haben, die Impfstoffe schon nach kaum einem Jahr zur Verfügung stellt (bei Ebola dauerte es noch 16 Jahre!) – sondern auch, weil nicht komplette Städte durch Bombenterror in Schutt und Asche gelegt werden und die Infrastrukturen der Versorgung gleich mit.
Sei dem wie dem sei: Corona hat uns mit dem neuerlichen Lockdown eine erstaunliche Besinnlichkeit und Entschleunigung (!) aufgezwungen. Und dafür sollte man der Pandemie wirklich danken.
Worin ich gar nicht einstimmen kann, das ist die Heraufbeschwörung eines weltweiten christlichen Weihnachtsgesummses. Zum einen, weil das den übrigen sechs Milliarden Nicht-Christen ziemlich egal sein dürfte oder ihnen nur übel aufstößt. Zum anderen, weil das Christentum zwei Jahrtausende lang unglaubliches Elend über die Welt gebracht hat – nämlich über viele dieser Nichtchristen – und über die jeweiligen “Ketzer” und “Reformwilligen”, die man in Folterkellern geschunden hat und bei lebendigem Leib verbrannte.
Das “liebe Jesuskind in der Krippe”, das da heuchlerisch an Weihnachten verehrt wird – geschenkt! Man hat es (wenn die Überlieferung zutrifft) am Kreuz elend zu Tode gequält und die Verheißung, der Gekreuzigte sei von den Toten auferstanden und “gen Himmel gefahren, sitzend zur Rechten Gottes” – das ist nur eine der vielen Lügen, die sich wunderbar in die Reihe der Missbrauchs-Skandale der Gegenwart einreiht – als “geistiger Missbrauch”. Denn was man da Kindern und Jugendlichen (von denen ich auch mal einer war) von kleinauf an Phantastereien und ja – Lügengeschichten – aufgetischt hat,. das geht wirklich auf keine Kuhhaut und ist kein gutes Vorbild für irgendjemanden in der heutigen Zeit.
Wissenschaft rettet uns vor Corona und dergleichen Misshelligkeiten – nicht Gebete und Aberglauben jeder Couleur.
Die christliche Kirche hat Jesus von Anfang an verraten (und damit sinnbildlich “ans Kreuz geschlagen”), indem sie Abweichler als Ketzer verleumdete und verfolgte und tötete – von den unzähligen “Ungläubigen” in anderen Ländern und Kulturen ganz zu schweigen, die der christliche Kolonialismus (“Machet euch die Erde untertan”) auf dem Konto hat, und gar zu schweigen von den Juden (die nicht missionieren!). Von wegen “Liebe deinen Nächsten…”, wie es das christliche Ur-Gebot fordert.
Drei Jahrzehnte dauerte der “Dreißigjährige Krieg” – ein Religionskrieg unter anderem. Es war natürlich (genau wie vor nicht allzu langer Zeit der Konflikt in Irland zwischen Katholiken und Protestanten) vor allem eine machtpolitische Auseinandersetzung – aber befeuert wurde sie von den Priestern auf beiden Seiten, die noch im Ersten Weltkrieg “die Waffnen segneten”. Oder die vom “Willen Gottes” faselten und schon zur Zeit der Kreuzzüge die abendländischen Mörderbanden auf die Juden und die Moslems hetzten (obwohl diese “Opfer” ihrerseits nicht zimperlich waren – Altes Testament und Koran legen davon beredtes Zeugnis ab).
Und dann ist da noch das ungeheure Elend, das nicht nur christliche Männer den Frauen überall auf der Welt bereitet haben – auch das “im Namen Gottes”. Eines “persönlichen Gottes” – der nichts weiter ist als eine Erfindung menschlicher Kreativität und Phantasie.
Ja, dieses Weihnachten erfüllt mich großem Zorn ob der Heuchelei allüberall. Aber ich freue mich natürlich auch, dass das Christentum (und die anderen Religionen) viel Gutes über die Menschen gebracht und sie gezähmt haben mit Geboten und Verboten. Was wäre mein Schreiben ohne die selbstausbeuterische Tätigkeit der fleißigen Mönche in den Klöstern, die nicht nur Kräuterpharmazie und medizinisches Wissen weitergaben – sondern auch die alten Manuskripte von Hand sorgfältig im Schein von Ölfunzeln abschrieben und abschrieben und abschrieben – bis ein gewisser Gutenberg und seinesgleichen ihnen die Arbeit abnahmen…
Und ja, Weihnachten erfreut mich auch, weil überall viel Hoffnung aufschimmert – trotz Christentum und seinem Aberglauben und dem der anderen Religionen. Denn die Naturwissenschaften und die von ihnen befeuerten Techniken erleichtern unser Leben, das dem “Paradies” schon sehr ähnlich ist, welches früheren Generationen nur für den Nimmerleinstag verheißenen wurde wie dem Esel die vors Maul gehaltene Karotte.
Und ebenfalls ja: Es gibt noch immer diese Idioten, die den Klimawandel leugnen – und wir sind für ihn verantwortlich – wir alle. Wir müssen etwas dagegen tun. Greta Thunberg hat nicht die Bibel in die Hand genommen, wie dieser dämonische Zundlfrieder im Weißen Haus, sondern sich selbst hin gestellt und gesagt: “Ich fürchte mich – das Haus brennt und ihr löscht nicht, sondern gießt Benzin ins Feuer” – oder so ähnlich hat sie sich ausgedrückt. Das ist “wahre christliche Nächstenliebe” (nennt sich nur zum Glück nicht so) – nicht wie das von weihnachtlichen Kirchenkanzeln herab (!) beschworene abergläubische Gerede, das sinnlos weiterverbreitet wird und mich schon als Kind angeödet und gelangweilt und rebellisch gemacht hat.
Naturwissenschaften und Technik retten uns in der Corona-Pandemie. Auch eine Folge wissenschaftlichen Denkens und Aufklärung: In Mitteleuropa herrscht seit 75 Jahren Frieden – unvorstellbar für frühere Generationen, von denen JEDE ihren Krieg hatte. Dass es andernorts kleinere Kriege und Gemetzel gibt, das werden künftige Generationen auch noch lösen. Da bin ich sehr hoffnungsvoll. Weil es das Vorbild “75 Jahren Frieden in Europa” gibt. So wie es seit Ende 1989 das Vorbild “Wiedervereinigung ohne Blutvergießen” gibt.
Dass überall die nationalistischen Scharfmachern wieder mit ihren Säbel rasseln – das gehört zum Rollback nach jeder positiven Entwicklung. Da lecken dann die Ewiggestrigen ihre Wunden, die Nazis kriechen wieder aus den Kellern, in denen sie sich versteckt hielten – Es ist ein ständiges hin und her. Aber 1941 stellte, mitten im Zweiten Weltkrieg, der englische Historiker Gordon Childe am Ende seiner Stufen der Kultur erleichtert fest:
“Der Fortschritt ist wirklich, wenn auch nicht immer stetig. Die aufwärts gerichtete Kurve löst sich in eine Reihe von Gipfeln und Tälern auf. Aber in den Gebieten, welche die Archäologie wie auch die geschriebene Geschichte überblicken können, sinkt kein Tal jemals bis auf das niedrigste Niveau des vorhergehenden ab, überragt jeder Gipfel den vorhergehenden.“
Es gibt kein “Entweder – oder” (“Deine Rede sei Ja Ja…”). Das ist unmenschlich. Menschlich ist nur das “Sowohl … als auch”. Die Entscheidungen eine Weile in der Schwebe halten. Das ist gelebte Demokratie. Das wäre für mich gelebtes Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus, Shintoismus, Animismus – ohne die Feindbilder von “Ungläubigen”.
Insofern hat das “Kind in der Krippe” doch auch etwas Tröstliches. Den aus ihm kann alles Mögliche werden. Es muss ja nicht unbedingt zum Gekreuzigten werden, der “sein Leben für uns gegeben hat”. Hat er nicht. Er wurde brutal getötet, Und das war´s. Und wir sind für unser Leben selbst verantwortlich – und in Grenzen auch für das unserer Mitmenschen. Diese Einstellung wird gerne als “Selbsterlösung” diffamiert. Aber es ist die einzig mögliche Variante.
Ende meiner Weihnachts-Predigt.
Bibliographie
Childe, Gordon: Stufen der Kultur. (1941) Stuttgart 1952 (Kohlhammer), S. 348.
Monopteros nah – Galaxien fern
Mit dem Fahrrad bin ich jetzt in einer Viertelstunde im Englischen Garten. Als wir noch in der Seestraße wohnten, waren es zu Fuß drei Minuten und da war der Nördliche Teil des Parks unser Auslauf. Heute, nachdem Umzug 2011, wurde, weil leichter erreichbar, der Südliche Teil hinter dem Haus der Kunst allmählich das Ziel. Hat einen großen Nachteil: Man ist fast mitten in der Stadt (was man am Straßenlärm merkt) und man ist eigentlich immer unter Horden anderer Menschen. Im Nordteil ist man fast allein und der Park hat mehr Naturcharakter.
Im Südteil spürt man überall die Künstlichkeit der Anlage – aber trotzdem ist es schön hier. Da ist zum einen das kleine Stauwehr hinter dem HdK – und da ist der Monopteros. Man hat sogar den Hügel künstlich angelegt, durch den er zum großartigen Aussichtsturm mit Rundblick in das Zentrum Münchens mit Hofgarten, Residenz, Theatinerkirche und Frauenkirche und Universität wird.

Aber eigentlich möchte ich von etwas ganz anderem berichten – einem großartigen Film, den ich mir immer wieder anschaue und der genau hier am Monopteros, auf der großen Wiese davor, beginnt: Zehn hoch – von und mit Prof. Harald Lesch.
Der Physiker und Naturphilosoph steht mitten im Grünen, vor dieseser passenden griechisch-antiken Kulisse, und erzählt von den heutigen Kenntnissen über die Natur. Sein Kunstgriff ist dabei, den Menschen (von ihm selbst verkörpert) als Ausgangspunkt und Maß zu nehmen – etwa ein bis zwei Meter, also “zehn hoch 0” misst der Kubus, von dem aus wir die Welt erfahren und gestalten – das “menschliche Urmaß” gewissermaßen.
Dann geht es in zunächst kleinen, dann immer gewaltigeren Sprüngen hinauf in den Himmel, dann den Weltenraum. “Zehn hoch eins”, das sind gerade mal zehn Meter. Aber dann sind es hundert, tausend … dann Kilometer … dann Lichtjahre … und schließlich, in zig Milliarden Lichtjahren Entfernung (“zehn hoch 26”) sind wir am Rand des beobachtbaren Universum – im Nichts, im absoluten Vakuum, wo Raum und Zeit aufhören. Theoretisch jedenfalls – denn dort war noch nie ein Mensch und dort wird auch nie einer sein.
Die Reise geht zurück, führt wieder zu Harald Lesch vor dem Monopteros – zoomt auf seine Hand. Und nun beginnt eine ebenso verblüffende Reise nach innen, wieder in Zehnerschritten: “zehn hoch minus 1” – bis “zehn hoch minus 35”, wo wir wieder im Nichts landen, wo nur ab und zu eine Quantenfluktuation im totalen Vakuum aufschimmert und wieder vergeht – niemand weiß woher sie kommt und wohin sie geht.
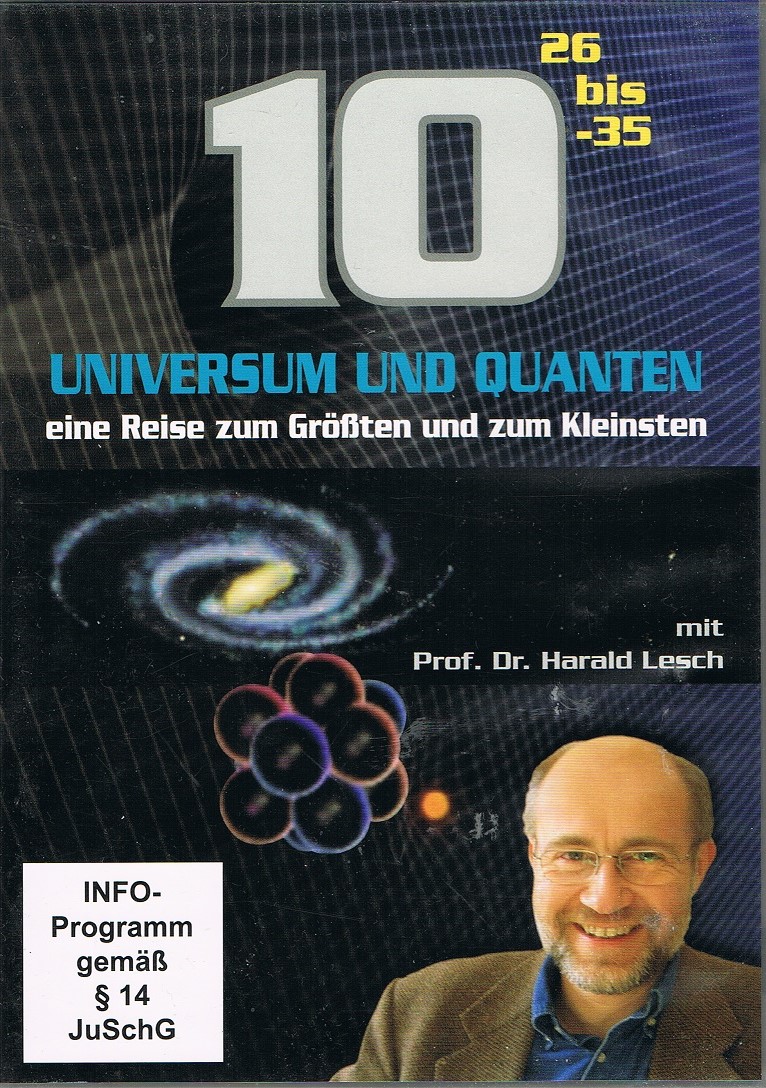
Diese Doku ist inzwischen zehn Jahre alt. Heute würde man das weit opulenter mit CGI in der Art ausgestalten und anreichern, die Science-Fiction-Filme wie Valerian und Guardians of the Galaxy und Passenger zu so atemberaubenden Hinguckern macht und wo man eine gewisse Ahnung davon bekommt, was das Universum nicht nur an grauenvoller Leere präsdentiert – sondern auch an unglaublicher Schönheit, wie jeder Blick in einen klaren nächtlichen Sternhimmel offenbart.
Aber diese Doku führt einem das Wesentlcihe vor Augen und das macht sie gut. –
Kleiner Wermutstropfen in dieses Lob: Was leider verschwiegen wird, ist das Vorbild dieses Films: Powers of Ten von Charles und Ray Eames aus dem Jahr 1977 (von IBM gesponsert) dauerte nur 9 ½ Minuten – aber es war bereits alles drin an Ideen und optischer Umsetzung, was in dem Film mit Lesch 85 Minuten dauert: Die Sprünge mit Zehner-Potenzen nach draußen ins Äußere Universum des Maktokosmos und zurück auf die Hand und von dort hinein in den Mikrokosmos. Nur platziert Eames die Geschichte in einen Park in Chicago – und Lesch nimmt den Englischen Garten in München als Kulisse. Doch der Film von Eames wird ebenso wenig erwähnt wie das großartige Sachbuch, das Philip und Physlis Morris aus Eames Filmchen gemacht haben: Zehn hoch: Dimensionen zwischen Quarks und Galaxien.
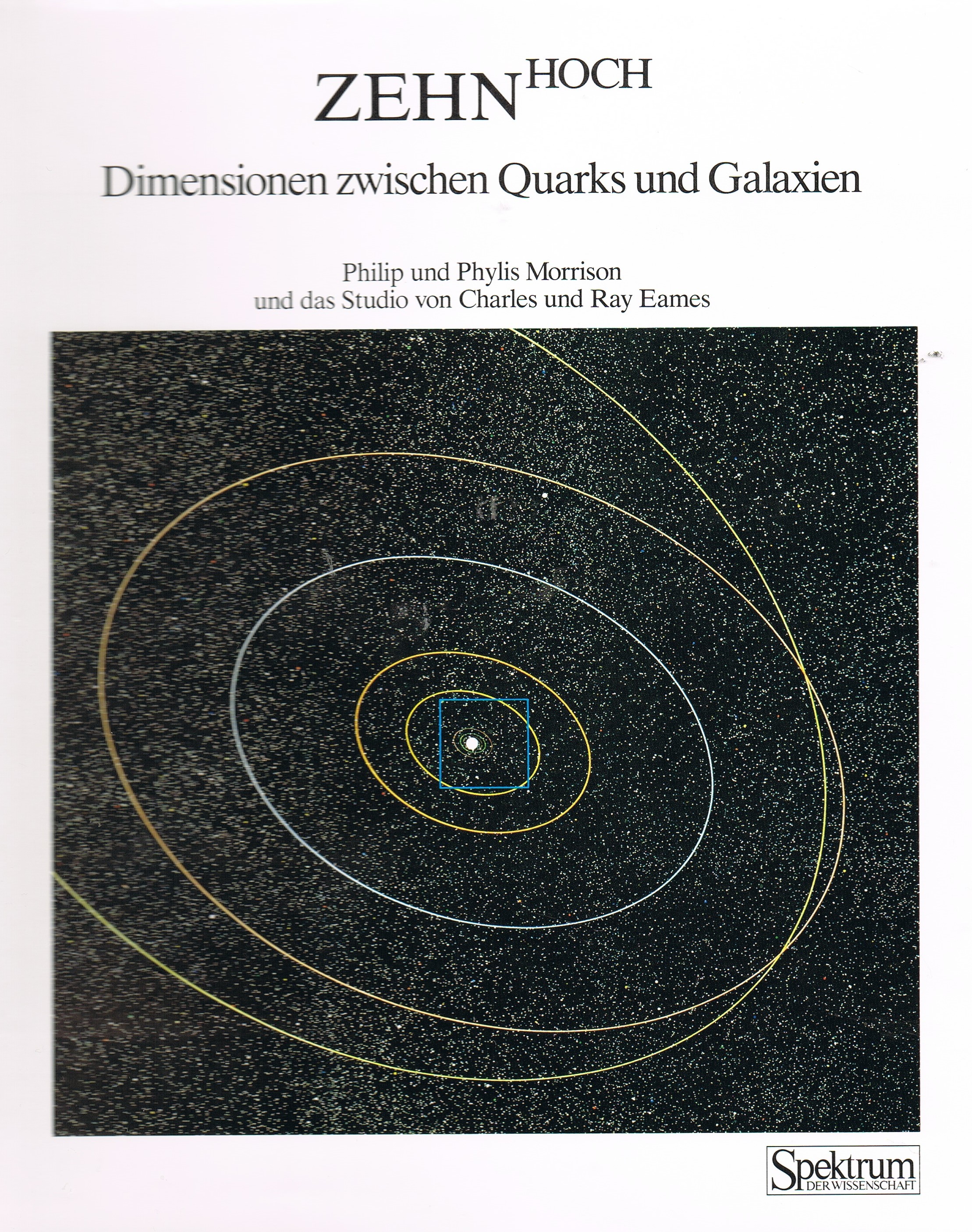
Bibliographie
Eames, Charles und Ray: Powers of Ten. USA 1977.
Morrison, Philip und Phylis: Zehn hoch: Dimensionen zwischen Quarks und Galaxien. (USA 1982).
Heidelberg 1984 (Spektrum der Wissenschaft).
Windorfer, Gerhard und Lenz, Herbert (und Harald Lesch als Sprecher und Moderator): 10 hoch 26 bis
minus 5: Universum und Quanten. München 2010 (Komplett Media).